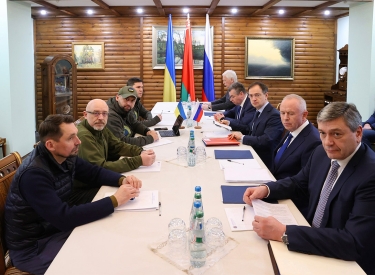Klein und bösartig
Nicht einmal die anderen Skandinavier können das Wahlergebnis in Dänemark so richtig verstehen. In dem Land mit gerade mal fünf Prozent Arbeitslosigkeit und einem Zuwandereranteil von sechs Prozent wurden am Dienstag der vergangenen Woche die regierenden Sozialdemokraten abgewählt, eine bürgerliche Koalition wird künftig regieren. So etwas passiert auch in den skandinavischen Demokratien immer wieder einmal, neu war dagegen, dass der Wahlkampf von Fremdenfeindlichkeit geprägt war.
Den bestimmte die rechtsextreme Dansk Folkeparti (DF) mit ihren einschlägigen Parolen, aber auch aus den anderen Parteien waren ähnliche Töne zu vernehmen. So glänzte die sozialdemokratische Innenministerin Karen Jespersen mit dem Vorschlag, kriminell gewordene Asylbewerber auf einer einsamen Insel zu isolieren. Und den belgischen Journalisten Dirk Evers erinnerte das Gerede Birthe Rønn Hornbechs von der konservativ-liberalen Venstre zum Thema Vaterland »an die Nazi-Ideologien«.
Venstre präsentierte auf einem Wahlplakat auch ein in Dänemark bekanntes Foto. Darauf waren vier junge palästinensische Männer zu sehen, die gerade das Gericht in Århus verlassen, nachdem sie wegen der Vergewaltigung eines dänischen Mädchens schuldig gesprochen wurden. »Zeit für Veränderung« stand unter dem Foto, Unterzeichner ist der Spitzenkandidat Anders Fogh Rasmussen.
Im Hinblick auf die Attentate vom 11. September kam es zudem zu recht merkwürdigen, wenn auch nicht gewollten Übereinstimmungen. Ein Bischof sprach davon, dass in Dänemark ein Religionskrieg gegen den Islam geführt werden müsse, während der Gründer und ehemalige Vorsitzende der rechtsextremen Fremskritts-Partei auf einer Pressekonferenz erklärte, dass das Land im Jahr 2039 »mohammedanisch« sein werde, wenn die neun im Parlament, dem Storting, vertretenen Parteien ihre »schlappe Haltung« nicht aufgäben. Falls seine Partei ins Parlament käme, sagte der 74jährige, dann werde sie als erstes einen Gesetzesvorschlag zur Schaffung eines »mohammedanerfreien Dänemark« vorlegen.
In der norwegischen Tageszeitung Aftonbladet versuchte sich der Dänemark-Korrespondent Ole Martin Larsen vergebens an einer Erklärung für den plötzlichen, gesellschaftlich tolerierten Rechtsruck des Landes: »In Dänemark herrscht ein Mangel an Ärzten, Ingenieuren und anderen fachlich versierten Arbeitskräften. Gleichzeitig fahren zahlreiche Flüchtlinge aus den gesuchten Berufen als Taxifahrer herum, verkaufen Gemüse oder backen Pizza - wenn sie nicht als Arbeitslose resigniert oder das Land bereits verlassen haben.«
Der dänische Schriftsteller Carsten Jensen nannte die Wahl ironisch »eine Volksabstimmung pro und contra Allah«, der die Sozialdemokraten nichts entgegengesetzt hätten. »Die Sozialdemokratie ist heute ein geplündertes Haus, dessen Flagge auf dem Dach von den Nachbarn geliehen ist. Das halbe Dänemark, die Hälfte, die offen, tolerant, neugierig und experimentierlustig ist und die die Zukunft und Umwelt nicht als Bedrohung empfindet, steht heutzutage ohne Sprachrohr da.«
Dieses Schweigen verwunderte auch die meisten Beobachter. Lars von Trier hatte zwar versucht, eine Kampagne in Gang zu setzen, aber sie blieb ohne Erfolg. Die Filmgesellschaft Zentropa, deren Miteigner der Regisseur ist, schaltete knapp eine Woche vor der Wahl eine ganzseitige Annonce, in der die Stimmberechtigten gebeten wurden, nur für Parteien zu stimmen, die sich von der rechtspopulistischen Dansk Folkeparti distanzierten. »Die Toleranz für Intoleranz muss hier aufhören«, hieß es in der Anzeige.
Zuvor hatte Lasse Dencik, ein aus Schweden stammender Professor für Sozialpsychologie an der Universität von Roskilde, in einem Interview mit der Zeitschrift Politiken scharfe Kritik am dänischen Wahlkampf geübt. Die Politiker hätten »den inneren Schweinehund losgelassen. Und der hat dadurch die Erlaubnis bekommen, im Wahlkampf völlig frei herumzulaufen.« Dencik erklärte, um etwas »Ähnliches zu finden«, müsse man »schon zurück ins Nazi-Deutschland der dreißiger Jahre schauen«, Dänemark drohe sich zu einem »kleinen, bösartigen, xenophobischen Land« zu entwickeln. Als das Schlimmste an diesem Wahlkampf, den er als vulgär, verrottet, dumpf und verfault beschrieb, empfinde er jedoch das Schweigen der Intellektuellen des Landes.
»Liebe intellektuelle Elite in Dänemark. Hallooo! Ist jemand da? Wir können euch nicht hören. Könnt ihr etwas verstehen? Hört ihr das Grummeln am Horizont etwa nicht, das Echo trampelnder Stiefel? Oder ist euch eure Selbstverliebtheit auf die Ohren geschlagen?«, fragte auch der Kommentator Torsten Lauridsen vom Fernsehsender TV2. »Verlangt Sendezeit! Bemächtigt euch der Kommentarspalten! Tut was, denn es ist schon fast zu spät.«
Und das war es dann auch. Die erste Wahl in einer westlichen Demokratie nach den Terroranschlägen vom 11. September brachte dramatische Verluste für die Sozialdemokraten. Nach neun Jahren sozialdemokratischer Regierung konnte die Venstre den Titel »stärkste Partei« für sich verbuchen. Die Auswertung der Wählerwanderung ergab zudem, dass von denjenigen, die beim letzten Mal noch sozialdemokratisch votierten, dieses Mal 26 beziehungsweise 35 Prozent für Folkeparti oder Venstre stimmten.
Nun wird es eine bürgerliche Koalition aus Konservativen, den Centrums-Demokraten und den in der Kristeligt Folkeparti (KF) zusammengeschlossenen Hardcore-Christen geben. Die DF, die zwölf Prozent der Stimmen erhielt, soll jedoch nicht mitregieren dürfen.
Und der designierte Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen von der Venstre beeilte sich zu versichern, dass die Folkeparti keinen entscheidenden Einfluss auf die Ausländerpolitik erhalten soll. Bei einem Treffen mit ausländischen Journalisten war er sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht. Vergleiche mit Situation in Österreich nannte er »lächerlich«. Man habe nichts mit Jörg Haider gemein, »es hat im Ausland wohl eine Menge Missverständnisse gegeben.«
Auf die Frage, wie er denn die den Wählern versprochene Einschränkung des dänischen Einwanderungsrechts schaffen wolle, ohne mit internationalem Recht in Konflikt zu geraten, antwortete er: »Wir werden diese Konventionen aufs Neue studieren. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt, wie wir die dänische Gesetzgebung verschärfen können.« Die Einwanderung solle gebremst werden, um dem Land »eine Verschnaufpause zu ermöglichen, in der die verfehlte Integrationspolitik verbessert wird«. Zunächst gelte es, »diejenigen in die Gesellschaft zu integrieren, die bereits hier sind und ihnen zum Beispiel Arbeitsplätze zu verschaffen«. Diskriminierende Maßnahmen seien »auf keinen Fall geplant«.
Kurz zuvor hatte Rasmussen vor Parteivorsitzenden und Journalisten im Kopenhagener »Publicistclub« abgestritten, dass er einer »reinen Rechtsregierung« vorstehen werde. Es werde keine Experimente geben, betonte er, man lege schließlich Wert darauf, dass nichts geschehe, was die Krone schwächen und die Zinspolitik beeinflussen könnte. »Die Wahl war ein Signal, dass die Integrationsprobleme gelöst werden müssen. Zuerst muss die Debatte jedoch in einer anständigen Tonlage geführt werden.«
Auch Jann Sjursen von der KF wiegelte ab: »Die Dänen haben es genauso nötig, in den dänischen Staat integriert zu werden, wie die Flüchtlinge und Einwanderer. Trotzdem empfinden manche von ihnen eine multiethnische Gesellschaft als angsteinflößend.«
Im übrigen Europa scheint man diesen Beteuerungen jedoch nicht ganz zu glauben. Im österreichischen Standard erschien bereits ein ironischer Kommentar, nach dem Österreich sich in der EU nicht mehr alleine fühlen müsse, nun, wo die blauschwarze Regierung mit Dänemark einen Partner im Geiste habe.
Die EU signalisierte Rasmussen, dass sie ein »europäisches Auftreten« von Dänemark erwarte, das in einem halben Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird. Die anderen europäischen Staaten würden genau verfolgen, ob die DF nicht doch Einfluss auf die bürgerliche Regierungskoalition nehme, erklärte auch Alain Gerlache, der Pressesprecher des jetzigen Ratspräsidenten Guy Verhofstadt. »Der Ton im dänischen Wahlkampf war lange bekannt. Jetzt wird es für die neue Regierung ernst.«