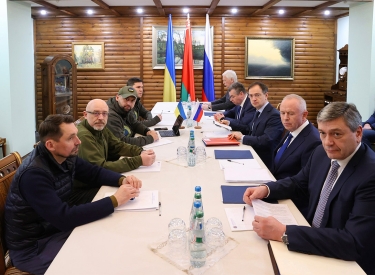Kein Herz für Europa
Für viele gilt der Nationalstaat in Europa als Relikt einer Epoche, die sich langsam, aber sicher verabschiedet. Die wirtschaftliche Integration scheint die alten Grenzen überflüssig zu machen und die nationalen Entscheidungen mehr und mehr auf EU-Institutionen zu verlagern.
Zur gleichen Zeit vollzieht sich auch die gegenteilige Entwicklung. In fast allen Ländern Europas werden nationalistische Parteien und Bewegungen populär. Und auch die gescheiterten Referenden über die EU-Verfassung des vergangenen Jahres in Frankreich und den Niederlanden signalisieren, dass das Ende des Nationalstaats in Europa noch lange keine abgemachte Sache ist.
Über Jahrzehnte entwickelte sich die EU eher unspektakulär, was sich jedoch 2002 mit der Einführung des Euro und der größten Erweiterung der EU-Geschichte zwei Jahre später, dem Beitritt der osteuropäischen Staaten, dramatisch änderte. Die Einheitswährung macht zunächst die Unternehmer mobiler: Wenn sie in anderen europäischen Ländern günstigere Bedingungen vorfinden, wandern sie einfach ab. Nicht nur die Arbeitskräfte geraten damit unter erheblichen Konkurrenzdruck, sondern auch die nationalen Steuersysteme. Und nicht zuletzt führt die wirtschaftliche Integration zur Auflösung traditioneller sozialer Milieus, die oft jahrzehntelang die Gesellschaften kennzeichneten. Insbesondere die osteuropäischen Beitrittsstaaten sind nach langer gesellschaftlicher Stagnation von diesen Veränderungen betroffen. Sie orientieren sich seit den neunziger Jahren an dem Konzept eines deregulierten Kapitalismus und feiern mittlerweile beeindruckende Wachstumsraten.
Die slowakische Regierung etwa setzte radikale Maßnahmen wie die »Flat-Tax« durch, einen einheitlichen Steuersatz für die gesamte Bevölkerung – selbst Margaret Thatcher war in Großbritannien Ende der achtziger Jahre bei dem Versuch gescheitert, eine ähnliche Steuer einzuführen. Das »Superreformland« Slowakei hingegen zog kurz darauf umfangreiche Investitionen an, vor allem die Automobilindustrie entdeckte das Land mit den billigen Arbeitskräften und niedrigen Abgaben.
Dass die hohen Wachstumsraten nicht alle begeistern, merkte die Regierung in Bratislava allerdings spätestens im Juni dieses Jahres, nachdem sie die Parlamentswahlen klar gegen die Oppositionspartei Smer (»Die Richtung«) verloren hatte. Vor den Wahlen hatte Smer versprochen, die Reformgesetze rückgängig zu machen und die Preise für Lebensmittel, Medikamente und Bücher zu senken. Unter ihrem Vorsitzenden Robert Fico war es der Partei in den vergangenen Jahren gelungen, mehrere kleinere ehemalige kommunistische und sozialdemokratische Parteien zu integrieren und fast das gesamte Potenzial der unzufriedenen Wähler auf sich zu ziehen. Und davon gibt es viele.
Von den wirtschaftsliberalen Reformen profitierten zwar die gut ausgebildeten Facharbeiter, Selbständige sowie die Angehörigen der neuen Dienstleistungssektoren in den Städten. Bis zu den Beschäftigten in der Landwirtschaft oder Schwerindustrie – die im europäischen Vergleich hoffnungslos unproduktiv sind – reichten die Segnungen des neuen Wirtschaftswunders jedoch nicht. Dafür merken diese umso schneller, dass ihre Einkommen immer geringer, die Lebenshaltungskosten dafür umso höher ausfielen.
Die Reaktionen blieben nicht aus. Wer von freien Markt nicht viel zu erwarten hat, richtet seine Hoffnungen auf Nation und Staat, die wieder garantieren sollen, was in dem schnellen Transformationsprozess verloren ging: soziale Sicherheit und stabile gesellschaftliche Strukturen.
Die Interpretation abstrakter ökonomischer Prozesse in den Kategorien des nationalen Interesses macht es scheinbar möglich, die anonymen Mächte zu bändigen, die die Gesellschaften zu spalten drohen. Eine Strategie, die in ganz Europa erfolgreich von neuen populistischen Parteien aufgegriffen wurde.
Auch für diese Entwicklung bietet die Slowakei Beispiele an. Dort entstanden in kurzer Zeit neben Smer neue Parteien mit kurzen Namen, wie etwa Nadej (»Die Hoffnung«) oder Ano (»Ja!«), deren Führung sich vor allem aus ehemaligen Fernsehmoderatoren rekrutierte. Sie versprachen eine gerechtere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und polemisierten zugleich gegen Minderheiten, die das Gemeinwohl angeblich in Frage stellen.
Die Verbindung von sozialen Fragen und so genannten nationalen Interessen ermöglicht es auch, vermeintlich linke und rechte Themen zu verbinden. So profilierte sich Ján Slota, Vorsitzender der Slowakischen Nationalen Partei, vor wenigen Wochen, indem er ohne erkennbaren Anlass über die »brutale Magyarisierung der Süd-Slowakei« schwadronierte. Hunderttausende Ungarn hätten sich dort niedergelassen und die wirtschaftliche Macht übernommen, während die slowakische Minderheit im ungarischen Nachbarland im Verschwinden begriffen sei. »Wir werden in unsere Panzer steigen und Budapest zermalmen«, erklärte er.
Der brachiale Aufruf schadete ihm in der Wählergunst nicht: Seine Partei erzielte eines der besten Ergebnisse ihrer Geschichte. Bereits vor drei Jahren war er mit dem Vorschlag aufgefallen, jedem Roma, der sich freiwillig sterilisieren lasse, 20 000 Kronen (etwa 474 Euro) zu geben. Die slowakischen Parteien reagierten zwar empört, auch Smer wies damals den »Vorschlag« zurück – was Fico aber heute nicht daran hindert, gemeinsam mit den rechtsextremen Nationalisten und den klerikal-konservativen Christdemokraten die neue Regierung zu bilden.
Auch in Polen, das mit vergleichbaren Problemen wie der slowakische Nachbarstaat zu kämpfen hat, propagiert die Regierung von Premierminister Lech Kaczynski eine extrem nationalistische Politik. Um die Gesellschaft gegen die angeblich wachsende Gefahr durch Pädophilie zu schützen, empfahl er kürzlich die Wiedereinführung der Todesstrafe. Zusammen mit seinem rechtsextremen Koalitionspartner von der Liga der polnischen Familien möchte er über dieses Anliegen eine »europaweite Debatte« führen. Bereits in seiner Regierungserklärung ließ er verlauten, dass der Nationalstolz eine zentrale Kategorie seines Handelns sei. In der Schule solle wieder Zucht und Ordnung einkehren, die »Verbindung von Mann und Frau« gelte es zu schützen, die Kirche müsse wieder eine tragende Rolle in der Gesellschaft spielen. »Das Prinzip aller Prinzipien ist: Es ist gut, ein Pole zu sein!« fasste er seine Sicht auf die Welt zusammen.
Die Mobilisierung solcher nationalistischer Ressentiments ist jedoch nicht auf Osteuropa beschränkt. Zumindest zeitweise berühmt wurde der fiktive polnische Klempner, der in den Auseinandersetzungen um den EU-Verfassungsvertrag durch Frankreich geisterte – immer auf der Suche nach einem Job, bei dem er einen Kollegen in Paris oder Lyon unterbieten konnte. Bei dem anschließenden Referendum wurde der Vertrag klar abgelehnt. Das Spektrum der Gegner reichte dabei quer durch alle politischen Lager.