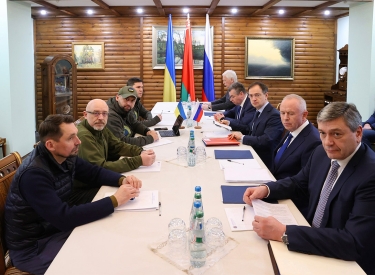Wenn Gurken neben Tomaten liegen
Vor zehn Jahren gab es den Nahen Osten nicht. Was es gab, war der »Nahost-Konflikt« zwischen Israel und den Palästinensern, der seit dem Osloer Abkommen von 1993 auch »Friedensprozess« hieß. Dies zumindest galt für die Berichterstattung und, da sie sowohl Spiegel als auch Teil der realen Verhältnisse ist, in gewissem Maße auch für den Nahen Osten selbst.
Mit dem Ende der palästinensischen Intifada 1991 begann ein Jahrzehnt lähmender Stagnation bei stetem sozialem und politischem Niedergang. Die Verhältnisse im Irak waren durch internationale Sanktionen »eingefroren«, der Libanon-Konflikt war vertagt worden. Die Petro-Oligarchien waren dank des damals weit niedrigeren Ölpreises handzahme Verhandlungspartner von schwindender strategischer Bedeutung. Und der Islamismus galt als zu vernachlässigende Größe, als Äußerung des Unmutes über westliche Dominanz. Das von den Taliban beherrschte Afghanistan schien weit und der Iran mit seinem Präsidenten Mohammed Khatami auf dem Weg des Wandels.
Große Veränderungen fanden in den vormals realsozialistischen Staaten des Ostens statt, über die dahinrollte, was Samuel Huntington als »Third Wave«, als dritte Demokratisierungswelle, bezeichnete. Im Vorderen Orient stand die Zeit einfach still. So zumindest konnte es erscheinen.
Tatsächlich spricht einiges für diese Wahrnehmung. In keinem der arabisch-nationalistischen Staaten (Irak, Ägypten, Syrien) gab es substanzielle Veränderungen, während sich die Modernisierung der Golfstaaten vorwiegend auf die technisch-ökonomische Infrastruktur beschränkte. Alle arabischen Staaten werden mehr oder weniger diktatorisch regiert, mit Ausnahme der Emirate durchliefen alle eine nicht enden wollende ökonomische Krise. In keinem dieser Staaten wurde die Regierung durch Wahlen abgelöst, in den meisten werden Presse und Opposition unterdrückt, in allen wird gefoltert.
Was darüber hinaus geschah, spielte sich im Stillen ab. Der systematische Krieg gegen die schiitische Bevölkerung im südlichen Irak wurde bestenfalls von Menschenrechtsorganisationen erwähnt, die Massaker der Islamisten in Algerien tauchten in den Medien als Randnotizen auf. Dem steht gegenüber, was als weltpolitischer Beitrag des Nahen Ostens galt: ein Händedruck zwischen Yassir Arafat und Shimon Peres, der Mord an Yitzhak Rabin und ein Besuch Ariel Sharons auf dem Jerusalemer Tempelberg.
Das alles hat sich geändert. Wie sehr, verrät bereits ein Blick auf die Hauptdarsteller des neuen Nahen Ostens: Saddam Hussein, Ussama bin Laden und Mahmoud Ahmadinejad stehen für eine destruktive Dynamik, die das Innere der nahöstlichen Gesellschaften zum Gegenstand internationaler Politik hat werden lassen. Dass dem so ist, haben sie, ganz entgegen ihrer Selbstwahrnehmung, ihrem größten Gegner zu verdanken, George W. Bush.
Bereits mit Amtsantritt kündigte Bush eine Umgestaltung der amerikanischen Nahost-Politik an. Nicht durch eine Einigung zwischen Israel und den Palästinensern sollten Probleme in der arabischen Welt gelöst werden, sondern umgekehrt sollte durch Veränderungen im arabischen Hinterland der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst werden. Es waren als »Falken« und Neocons verschriene Mitarbeiter im ersten Kabinett Bushs, die schon vor dem 11. September 2001 propagierten, was später zum Gemeinplatz wurde. Unfreiheit, Unterdrückung und religiös oder ideologisch verbrämte Feindseligkeit als legitimatorische Basis von Regierungen machen die Region unsicher und zur Bedrohung auch der USA und Europas.
Diktatoren und Autokraten benötigen einen äußeren Feind, um ihre Herrschaft nach innen zu rechtfertigen. Sie sind unzuverlässige Partner und unangenehme Nachbarn. »Entweder wir befreien sie, oder sie zerstören uns«, fasste Bernard Lewis zusammen. Erstmals griffen die USA als eigenständige Macht – und nicht an der Seite befreundeter Regierungen – in die Entwicklung des Nahen Ostens ein, und zwar nicht, um den Status quo ante wiederherzustellen, sondern um ihn grundlegend zu verändern.
Im Falle des Irak mag es so scheinen, als habe diese Politik mehr Probleme geschaffen als gelöst. Tatsächlich steht, wer mit der Befreiung vom Terror des Ba’ath-Regimes auch die Hoffnung auf eine Befreiung der Gesellschaft verband, derzeit vor der ernüchternden Einsicht, dass die Probleme nahöstlicher Gesellschaften durch den Sturz monolithischer Staatsapparate alleine nicht gelöst werden können. Die destruktive Dynamik, die mit dem Ende der ba’athistischen Diktatur im Irak freigesetzt wurde, hat dem Diktum Bernard Lewis’ eine weitere bedrückende Variante hinzugefügt: Wenn wir sie nicht befreien, zerstören sie sich selbst. So in etwa könnte man die Bitte der irakischen Regierung übersetzen, die Stationierung amerikanischer Truppen im Lande wenigstens bis Ende 2008 zu verlängern.
Die alliierte Intervention im Irak hat einer der grausamsten Diktaturen in der Geschichte des Nahen Ostens ein Ende bereitet und auch dafür gesorgt, dass Israel einen Feind weniger hat, der ihm beständig mit Vernichtung droht. Es wurden aber auch jene Probleme offen gelegt, die in allen arabisch-islamischen Gesellschaften existieren und lediglich mehr schlecht als recht verborgen werden. Denn es handelt sich bei diesen Staaten, ob sie, wie Ägypten, von den USA alimentiert werden oder, wie Syrien, sich als Speerspitze des Antiimperialismus verstehen, um potenzielle failed states. Einzig immense aus Ölrenten oder Hilfsgeld finanzierte Bürokratien und Repression halten sie noch zusammen.
Die derzeit im Irak ausgetragenen Konflikte wurden nicht von amerikanischen Truppen eingeschleppt. Die Unterdrückung nicht arabischer und nicht muslimischer Bevölkerungsgruppen, das extreme Übergewicht des Militärischen, auch in der Innenpolitik, der Bankrott der Staatswirtschaft und die fortschreitende Pauperisierung der Bevölkerung unter Saddam Hussein schufen die Grundlage. Gesellschaftliche Merkmale wie die brutale Unterdrückung von Frauen, das Fehlen einer einflussreichen und eigene Interessen vertretenden Bürgerschicht, die Vernichtung oder Exilierung der Intelligenz, die Entstehung illegaler Strukturen in verelendeten Landstrichen, die anhaltend große Bedeutung von Familien- und Clanstrukturen und die weitgehende Bedeutungslosigkeit des Individuums sind keine Besonderheiten des Irak. Sie finden sich in den meisten Staaten der Region, allerdings ließ die extreme diktatorische Gewalt des Ba’ath-Regimes sie besonders scharf hervortreten.
Wer geglaubt hatte, staatliche oder gar zivilgesellschaftliche Strukturen hätten den Ba’athismus überlebt, wurde enttäuscht. Mit Saddam Hussein, seinen Geheimdiensten und der Partei verschwand, wie der irakische Intellektuelle Kanan Makiya richtig bemerkte, auch der Staat, ja jegliche gesellschaftliche Organisation, die auf Vermittlung hätte beruhen sollen.
Was im Irak geschah, gab auch einen Einblick in die im Nahen Osten herrschende Realität. Die Einsicht, dass weder der Verlauf der israelischen Grenze noch der Spotmarktpreis für Öl, sondern die nahöstlichen Gesellschaften den seit Jahrzehnten gewaltsam ausgetragenen Konflikt mit sich selbst und der Welt erzeugen, hat der Irak-Krieg nur in besonders brutaler Form bestätigt. Die Autokratien andernorts sind nicht deshalb demokratischer, weil sich eine Mehrheit findet, die sich ohne äußersten Zwang in die Unfreiheit begibt. Und sie sind, wie es die Hamas derzeit vorführt, auch nicht stabiler.
Mit dem Ausbruch der so genannten al-Aqsa-Intifada entstand die Einheitsfront der »nationalen und religiösen Kräfte«, gekennzeichnet von einer Mischung aus realer und ideologischer Perspektivlosigkeit einerseits, religiös begründeter und kompromissloser Feindbestimmung andererseits. Um den mäßigenden Zwang staatlicher Institutionalisierung gebracht, tritt in Gaza wie im irakischen Bakuba zu Tage, was die Basis der autoritären Mobilisierung im Nahen Osten ist: der beständige Zwang unter das zuerst familiäre, dann nationale oder islamische Kollektiv, die vollständige Unterwerfung des Individuums und die im Zelebrieren rohester Gewalttätigkeit zum Ausdruck gebrachte Veräußerlichung einer lang anhaltenden Unterdrückungsleistung, die vom Kindesalter an das Leben bestimmt.
In Gaza wie in Bakuba wird zugespitzt ein Konflikt ausgetragen, der die Gesellschaften des gesamten arabischen Ostens kennzeichnet. Anhänger von al-Qaida, die im Irak Gemüsehändler ermorden, weil diese Gurken neben Tomaten verkaufen, also angeblich männliche und weibliche Symbole vermischen, führen nur konsequent einen tödlichen Wahn zu Ende, der längst normativ geworden ist.
Wenn die Länder des Nahen Ostens sich nicht einer radikalen Transformation unterziehen, die alle Bereiche erfasst, wird ihre Zukunft weniger rosig aussehen als die Somalias. Die Zeit der großen ideologischen Aufbrüche ist vorbei, die arabische Welt spielt selbst in innerarabischen Konflikten keine Rolle mehr. Nirgends zeitigen Initiativen der Arabischen Liga auch nur die geringsten Resultate. Die Initiative ist auf andere Akteure, seien es die USA, der Iran, die Türkei oder Äthiopien, übergegangen.
Diese ernüchternde Bestandsaufnahme ist allerdings zugleich Diagnose, also Grundlage jeder möglichen Verbesserung. Denn was vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ist heute vielerorts Realität: Liberale Stimmen werben für Alternativen, wenn auch noch aus einer Minderheitenposition. Im Irak gingen Millionen an die Wahlurnen, und jenseits des Explosionsrauches entwickelten sich unzählige Initiativen, die für eine Verbesserung konkreter Lebensbedingungen kämpften. Diesen Menschen ist, trotz täglicher Bedrohung durch Islamisten und repressive Regimes, inzwischen bewusst, dass keine Heilsideologie ihre Lage wird verbessern können.
Und so schließt sich der Kreis. Vor zehn Jahren schien der Status quo im Nahen Osten unendlich verlängerbar. Doch die vermeintliche Stabilität entpuppte sich als ein nur oberflächlich verdecktes, gewalttätiges Chaos, das nun zu Tage tritt und damit auch erstmals die Chance auf reale Veränderung bietet. Diese Veränderung, also eine Demokratisierung, Säkularisierung und Liberalisierung des Nahen Ostens, ist die einzige Alternative. In dieser Hinsicht haben die Neocons Recht behalten. Die meisten europäischen Regierungen dagegen haben bis heute nicht verstanden, was auf dem Spiel steht, und verharren, in selbstgerechtem Antiamerikanismus, in einer Position, die bereits vor zehn Jahren falsch war und seitdem zur Ausbreitung von Chaos und Gewalt beigetragen hat.