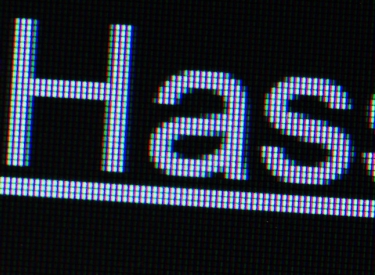Die Hüter der Wahrhaftigkeit
»Netzwerkdurchsetzungsgesetz« hat Bundesjustizminister Heiko Maas sein Vorhaben getauft. Es geht darum, den sozialen Medien angesichts omnipräsenter Manipulation der Bürger durch Falschmeldungen, Lügen und »Hass« Selbstverpflichtungen zwecks politisch-moralischer Reinhaltung der Kommunikation aufzuerlegen. Die sozialen Netzwerke sollen, geht es nach Maas, künftig präventiv darüber entscheiden, welche der in ihnen verbreiteten Inhalte als Volksverhetzung, Beleidigung, Falschmeldung oder Schmähung einzustufen und zu löschen sind. Ihr Entscheidungsspielraum soll dabei freilich eng bemessen sein. Durch hohe Bußgelddrohungen im Falle nicht erfolgter Entfernung inkriminierter Inhalte und knappe Fristen für deren Löschung (in der Regel binnen 24 Stunden) soll darauf hingearbeitet werden, dass fake news und hate speech schon bekämpft werden, bevor Betroffene die Löschung möglicherweise rechtswidriger Äußerungen einfordern. Außerdem sollen die Betreiber sozialer Medien quartalsweise darüber Bericht erstatten, welche Inhalte sie gelöscht haben.
Die Überzeugung, in einer authentischen Demokratie gelte es, die Gewaltenteilung durch aktiven Bürgersinn zu überwinden und die Medien zu animieren, sich zu politisch-moralischen Exekutoren des Staatszwecks zu machen, hat hierzulande noch immer am meisten Anhänger.
Neben die bestehenden Möglichkeiten juristischer Verfolgung treten damit Formen zivilgesellschaftlicher Kontrolle und Sanktionierung, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke stellvertretend ausgeübt werden sollen. Insbesondere der dem Selbstverständnis nach linke Teil der Öffentlichkeit zeigt sich von der Idee einer Delegierung juristischer Aufgaben an die Zivilgesellschaft begeistert.
Heribert Prantl kritisiert Maas’ Pläne in der Süddeutschen Zeitung nicht etwa für eine drohende Entmachtung der Judikative, sondern wegen der Gefahr, die Meinungsmacht könne noch stärker als zuvor der »Hand privater Unternehmen« überantwortet werden: ein Vorbehalt ganz im Sinne deutschen Ressentiments. Die Taz bedankt sich bei Maas im Gerhard-Schröder-Stil, weil er Facebook und Twitter nun endlich »Dampf« mache. In der Jungle World dekretiert Enno Park, »Meinungsfreiheit« sei »kein Freifahrtticket, seine Mitmenschen in sozialen Medien verbal zu terrorisieren«, und lobt Maas’ Pläne als einen »Schritt in die richtige Richtung«, dem weitere folgen müssten. Parks Mitdiskutant Stefan Laurin sieht in der Möglichkeit, dass die sozialen Netzwerke künftig mehr Inhalte löschen als zuvor, vor allem die Gefahr, Facebook und Twitter könnten zu »ziemlich langweiligen Orten« werden – was mehr über den Abwechslungsreichtum seines eigenen Alltags als über den Gegenstand der Debatte aussagt. Maxine Bacanji schließlich findet Maas’ Vorhaben völlig unproblematisch, weil es die »Rechtsdurchsetzung« fördere, und verlangt dessen Ausweitung auf andere Formen von »Onlinehass«, den sie als Resultat einer veritablen Verschwörung anzusehen scheint: »Ganze Trollringe schließen sich zusammen, um einzelne Personen aus dem Internet zu vertreiben. Viele dieser Tweets sind nicht als Beleidigung oder üble Nachrede verfolgbar.« Dabei ist doch Vertreibung, das weiß man unter Deutschen, das schlimmste Verbrechen überhaupt.
Bei Internet-Trollen, denen hier eine Nähe zu Kinderhändlern und Zuhältern angedichtet wird, die sich bekanntlich auch in klandestinen »Ringen« organisieren, handelt es sich keineswegs immer um in der Anonymität verborgene Straftäter, sondern oft genug nur um Leute, die ihren Mitmenschen lästigfallen, weil sie sie penetrant an die eigene Blödheit erinnern. Ihre Postings lassen sich nicht allein deshalb schwer als »Beleidigung oder üble Nachrede« verfolgen, weil sich ihre Identität in den fluiden Verkehrsformen der neuen Medien selten ermitteln lässt, sondern auch, weil es häufig keinen juristischen Grund gibt, gegen sie vorzugehen. Nicht jeder, der sich durch andere beleidigt fühlt, ist schon deshalb Opfer einer Straftat. Überhaupt fällt an der Debatte über fake news und hate speech auf, wie wenig Mühe aufgewendet wird, um metaphorische Wendungen wie die vom »verbalen Terror« oder »Onlinehass« juristisch stichhaltig zu konkretisieren. »Hass« ist zunächst überhaupt kein Delikt, sondern ein Gefühl und wird nur in bestimmten Konstellationen als Motiv rechtswidriger Handlungen justitiabel. »Terror« üben gegenwärtig vor allem Personengruppen aus, die in ihrem ebenso notorischen wie grundlosen Beleidigtsein durch die Zivilisation jenen Maas-Freunden ähneln, welche am liebsten jede von der eigenen Meinung abweichende Wortäußerung aus dem Internet entfernt sähen.
Die sozialen Netzwerke sind auch keineswegs, wie Laurin meint, »Räume unseres Lebens geworden, in denen wir uns so selbstverständlich und sicher bewegen sollten wie überall sonst«, sondern Kommunikationsmittel in einer nach wie vor analogen Wirklichkeit, die nicht dadurch verschwindet, dass die Facebook-Androiden ihr seit Jahren keinen Besuch mehr abgestattet haben. Mit der Verwechslung von analoger und digitaler Realität scheint ein entscheidendes Missverständnis in der Diskussion über fake news und hate speech zusammenzuhängen. Die sozialen Netzwerke werden darin tendenziell wie Publikationsorgane, vergleichbar Zeitungen und Zeitschriften, behandelt. Tatsächlich sind sie lediglich Foren zwecks Verbreitung von Mitteilungen, Stimmungen, Sinn und Schwachsinn sowie (mitunter justitiablen) Meinungen. Juristisch ist ihr Status eher vergleichbar mit der Post, die auch nur unter eng gefassten Voraussetzungen dafür verantwortlich gemacht werden kann, wenn sie »Hass« oder »Lügen« verbreitet. Rechtliche Verantwortung dafür tragen die Urheber der Postings, nicht die von den Urhebern genutzten Kommunikationsmedien.
Die Anhänger von Maas’ »Netzwerkdurchsetzungsgesetz«, die mehrheitlich schon mit seinen früheren Plänen zum Verbot »sexistischer« Werbung sympathisiert haben dürften, würden wohl zumindest nicht laut protestieren, wenn die Post sich weigern würde, Werbematerial der AfD zuzustellen, die ja schließlich, wenngleich nicht verboten, ebenfalls Hass verbreitet. Die lässig vorgetragene Ansicht, durch Delegierung von Funktionen der Judikative an die sozialen Netzwerke werde die »Rechtsdurchsetzung« gefördert, ist genuiner Ausdruck deutscher Ideologie, die sich heute emanzipatorisch und weltoffen geriert. In einer parlamentarischen Demokratie ist die Rechtsdurchsetzung Aufgabe der Exekutive, die Zivilgesellschaft volksdeutschen Zuschnitts dagegen möchte Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung ein und derselben, nämlich der eigenen, Hand anvertrauen. Medienpolitisch entspricht dieser Haltung in Deutschland die feste Überzeugung, dass Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit sich zu Bütteln schnöder Interessen machen, sofern sie sich auf ihre Zwecksetzungen der Information und Meinungsbildung konzentrieren. Vielmehr haben sie sich wahrhaftig, moralisch integer und gemeinschaftsstiftend zu präsentieren.
Ihre drastischste Ausdrucksform fand diese Anmaßung in der Konvergenz von Moralismus und Lüge, Meinungshygiene und Volksgemeinschaftspropaganda im Nationalsozialismus. Das Heimtückegesetz von 1934 schränkte nicht einfach die freie Meinungsäußerung ein und kriminalisierte Kritik am Staat, wie es das Allerweltsverständnis von »Diktaturen« erwartet, sondern legitimierte jegliche im Namen der Volksgemeinschaft betriebene Denunziation, Verunglimpfung und Hetze. Als Vertreter der Wahrhaftigkeit galt seither, wer völkisch korrekt log, diffamierte und verleumdete, als Verbreiter von Desinformation, wer die Wahrheit darüber sagte, was mit den jüdischen Nachbarn geschah. Gleichzeitig wurden alle Volksgenossen angehalten, Verbreiter von »Heimtücke« bei den lokalen Blockwarten zu melden, deren volkshygienische Maßnahmen von den Gerichten dann nur noch nachträglich gebilligt werden mussten. Welche konkreten Formen die Überantwortung der »Rechtsdurchsetzung« an Agenturen der Zivilgesellschaft annehmen kann, wurde damit schlagend vor Augen geführt.
Die Überzeugung, in einer authentischen Demokratie gelte es, die Gewaltenteilung durch aktiven Bürgersinn zu überwinden und die Medien zu animieren, sich zu politisch-moralischen Exekutoren des Staatszwecks zu machen, hat hierzulande noch immer am meisten Anhänger. Nur wird sie nicht mehr unmittelbar im Namen der Volkshygiene, sondern der Imperative einer kultursensibel und antisexistisch aufgenordeten Zivilgesellschaft ausgelebt, die mit ihrem angloamerikanischen Pendant, der civil society, so wenig zu tun hat wie die deutsche Basisdemokratie mit dem liberalen Parlamentarismus. Dass Leute, die sich jederzeit ohne Zögern als Staatskritiker bezeichnen würden, solche Tendenzen zur zivilgesellschaftlichen Formierung mit dem Eifer devoter Mandatsaspiranten abfeiern, statt sie zu denunzieren, sagt alles über den Zustand einer Öffentlichkeit, die nur noch aus Gewohnheit so genannt wird.