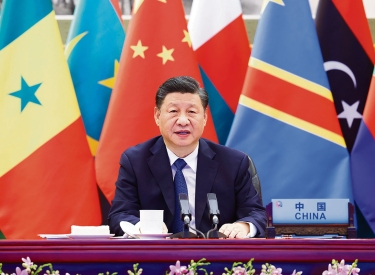»Chinas Aktivitäten sind kapitalistisch motiviert«
Bei dem zurückliegenden Chinesisch-afrikanischen Kooperationsforum (FOCAC) in Dakar versprach China Entwicklungshilfe und Investitionen in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar, vor drei Jahren waren es 60 Milliarden. Will China seine Investitionen in Afrika reduzieren?
Tatsächlich ist diese Summe kleiner, nicht jedoch, wenn man auch den Wert der eine Milliarde Covid-19-Impfdosen dazurechnet, die die chinesische Regierung in den kommenden Jahren den afrikanischen Ländern zu liefern versprochen hat. Doch wichtig ist, wie das Geld verwendet wird. Es hat sich gezeigt, dass viele afrikanische Länder einfach nicht mehr Kapital absorbieren können. Deshalb versucht man, das Geld gezielter zuzuweisen.
Ist das eine Reaktion auf die gewachsene Belastung durch Verschuldung bei China?
Nicht ganz Afrika hat dieses Problem, sondern ungefähr zehn afrikanische Länder, darunter Angola, Sambia, Äthiopien, Djibouti oder auch Nigeria. Chinas Wirtschaftsbeziehungen nach Afrika sind auf zehn bis 15 Länder konzentriert, und so ist es auch mit den Krediten. Stattdessen soll jetzt der Fokus auf kleineren, leichter zu verwirklichenden Projekten liegen. Anstatt um Milliarden für umfassende Infrastrukturprojekte geht es um zehn bis 15 Millionen, vielleicht 50 bis 100 Millionen US-Dollar für Dinge wie Kraftwerke, Solarenergie, Smart-City-Programme, Investitionen in Ausbildung und das Gesundheitssystem. Viele Analysten sagen, dass China seine Strategie angepasst hat.
»Die Firma Transsion aus Shenzhen entwickelt Handys direkt für den afrikanischen und südostasiatischen Markt, sie verkauft mittlerweile mehr als die Hälfte aller Smartphones in Afrika.«
Wie dramatisch ist das Problem der Verschuldung bei China für diese Länder?
Die chinesischen Kredite erregen viel Aufmerksamkeit, aber in vielen Ländern ist die Verschuldung bei privaten Geldgebern, zum Beispiel durch in US-Dollar oder Euro ausgegebene Eurobonds mit hohen Zinsraten, ein noch größeres Problem. Wir sollten auch nicht vergessen, dass der Internationale Währungsfonds, die Weltbank oder der Pariser Club (ein internationales Gremium geldgebender Länder, das über Umschuldung für ärmere Staaten berät, Anm. d. Red.) ebenfalls wenig tun, um die derzeitige afrikanische Schuldenkrise zu bekämpfen. Auch für die G20 hat das Thema keine Priorität. Das sogenannte Schuldenmoratorium der G20, das die Bedienung von einigen Krediten während der Covid-19-Pandemie ausgesetzt hat, endet zum Jahreswechsel. Weder für die USA noch für die EU ist die Schuldenkrise der armen Länder eine Priorität. China argumentiert, dass es einige der Staatsschulden umstrukturiert und die Zahlung verschoben hat, aber anders als die europäischen Geldgeber das in der Vergangenheit getan haben, stellt China keine Schuldenerlasse in Aussicht.
China wird oft dafür kritisiert, Länder in eine »Schuldenfalle« zu treiben. So gab es in den vergangenen Wochen Berichte, chinesische Geldgeber würden wegen nicht zurückgezahlter Kredite die Kontrolle über den Flughafen von Entebbe in Uganda übernehmen.
Das war einfach schrecklicher Journalismus. Die Rückzahlung des fraglichen Kredits ist noch gar nicht fällig. Es gab einen ähnlichen Fall mit einem Kredit in Höhe von 400 Millionen US-Dollar voriges Jahr in Nigeria: Die Leute lesen im Vertrag vom »Verzicht auf Staatenimmunität« und sind entsetzt. Dabei bedeutet dieser Satz nur, dass sich das Schuldnerland im Fall von Zahlungsschwierigkeiten nicht auf seine Souveränität zurückziehen kann. Ich glaube, diese Ängste sind auch Ausdruck eines historischen Traumas afrikanischer und anderer Länder, denen im Kolonialismus derartige Enteignungen widerfahren sind. China tut viele schlechte Sachen in Afrika, ohne Zweifel: Umweltzerstörung, Korruption, die Liste ist lang. Aber es versucht nicht, sich durch die Vergabe von Krediten Kontrolle über Infrastruktur anzueignen.
Also gibt es eine solche »Schuldenfallendiplomatie« Chinas nicht?
Wir verfolgen diese Fälle sehr genau, und es gibt keine Belege dafür. Das Narrativ ist jedoch sehr hartnäckig, nicht nur in Afrika, sondern auch in den USA und der EU. In gewisser Weise folgt die Vorstellung einer »Schuldenfalle« dem sehr westlichen Skript, sich Imperialismus als Aneignung von Territorium und Infrastruktur vorzustellen, was ja dem entspricht, was die westlichen Länder in der Vergangenheit getan haben. Chinas Aktivitäten in der Welt sind derzeit eher kapitalistisch motiviert, es geht um die Rendite. Deshalb fordern chinesische Geldgeber Sicherheiten – weil sie ihr Geld zurückhaben wollen. Wenn man mit den Chinesen spricht, die diese Investitionsentscheidungen treffen, wird einem klar: Sie sind nicht am Flughafen von Entebbe, dem sambischen Staatsfunk ZNBC oder dem Hafen von Mombasa in Kenia interessiert, wie viele befürchteten. Das sind alles keine profitablen Unternehmen, zudem wären sie extrem schwer zu managen. Das Narrativ von der chinesischen »Schuldenfalle« führt dazu, dass man die wirklich problematischen Aktivitäten Chinas in Afrika übersieht, den unregulierten Bergbau, die Umweltzerstörung und so weiter.
Wie unterscheidet sich der westliche Entwicklungshilfeansatz von dem Chinas?
Anfang Oktober lud der französische Präsident Emmanuel Macron beim Frankreich-Afrika-Gipfel in Montpellier junge Afrikaner ein, ihm auf der Bühne zu sagen, was sie von Frankreich erwarten. Und diese jungen Menschen waren ziemlich wütend und frustriert. Eine Botschaft war: Wir haben die Entwicklungshilfe und den Paternalismus, der damit einhergeht, satt. Als ich in Kinshasa im Kongo gelebt habe, sah ich 26jährige Entwicklungshelfer, die riesige Budgets kontrollierten, aber weder die Sprache noch die Lebensbedingungen der Menschen kannten, an die sie das Geld verteilten. Und gleichzeitig sieht man ständig Korruption im Entwicklungshilfegeschäft. Afrikanische Regierungen sagen in Verhandlungen mit China: Wir wollen keine Hilfe, wir wollen business, Investitionen, Arbeitsplätze, Industrie. Und tatsächlich leistet China weniger klassische Entwicklungshilfe und investiert stärker in den Aufbau der Wirtschaft, um Straßen, Kraftwerke und Eisenbahnlinien zu bauen oder Huawei beim Aufbau von Telekommunikationsinfrastruktur zu unterstützen.
Warum sind einige chinesische Firmen in Afrika so erfolgreich?
Investitionen in Afrika sind mit hohen Risiken verbunden und der chinesische Staat unterstützt diese Firmen dabei, sei es direkt oder über staatliche Entwicklungsbanken. Ein anderer Grund ist, dass chinesische Firmen mehr Erfahrung damit haben, in ärmeren Ländern des globalen Südens zu operieren. Die Firma Transsion aus Shenzhen beispielsweise entwickelt und vermarktet Handys direkt für den afrikanischen und südostasiatischen Markt, sie verkauft mittlerweile mehr als die Hälfte aller Smartphones in Afrika. Ein ähnliches Beispiel ist Star Times, ein Anbieter von Satellitenfernsehen.
China hat versprochen, seine Importe aus Afrika auf 300 Milliarden US-Dollar jährlich zu erhöhen. Woraus werden diese Importe bestehen?
Derzeit liegt der Wert der chinesischen Importe bei über 100 Milliarden US-Dollar. Das in drei Jahren zu verdreifachen, ist ambitioniert. Die landwirtschaftlichen Importe sollen erhöht werden, aber das wird nicht ausreichen, es müssen auch höherwertige Waren und Industriegüter sein. Afrika muss in der Wertschöpfungskette aufsteigen.
Passiert das denn?
Es gibt viele Herausforderungen, am wichtigsten ist die Infrastruktur. Fabriken brauchen verlässliche Stromversorgung und verlässliche Transportinfrastruktur. Deshalb sind die chinesischen Industrieinvestitionen in einigen bereits etablierten Zentren konzentriert, etwa Südafrika, Marokko oder Algerien. Mineralien machen einen großen Teil der chinesischen Importe aus, Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo wird immer wichtiger. Aber die Frage ist, ob diese Mineralien auch in Afrika verarbeitet werden. Es ist sehr schwer, da mit den chinesischen Firmen zu konkurrieren, die staatlich unterstützt und subventioniert werden. Ähnlich ist es ja mit den Landwirtschaftssubventionen der EU. Also ist offen, ob das 300-Milliarden-Ziel auch erreicht werden kann. Aber ich kann sagen, dass die afrikanischen Teilnehmer des Gipfels ziemlich begeistert waren, denn das Importziel drückt aus, dass China optimistisch ist, was das Potential Afrikas angeht. Die USA und die EU scheinen Afrika immer noch primär als hoffnungslosen Fall zu sehen, als den Kontinent der Kriege, der Hungersnöte, der Kindersoldaten und der Krankheiten wie Aids und Ebola.
Ist es nicht auch ein Vorteil Chinas, dass es nicht einmal Lippenbekenntnisse für Rechtsstaat und Demokratie abgibt und deshalb für autoritäre und korrupte Regierungen der angenehmere Partner ist?
Ja, aber man muss ehrlich sagen, dass das nicht nur auf China zutrifft. Ich will China nicht verteidigen, aber der zweitwichtigste Empfänger von US-Geld ist Ägypten. Aber in der Tat hat China einen anderen Ansatz. Wir sehen das beispielsweise derzeit im Fall Äthiopiens und der Gewalt in Tigray. Die USA und die EU fordern Sanktionen gegen die äthiopische Regierung, aber China sagt, das sei eine innere Angelegenheit. Im Westen kritisiert man an Chinas strikter Nichteinmischungspolitik, dass sie Diktatoren freie Hand lässt, aber viele ehemals kolonialisierte Länder sehen darin einen Schutz gegen äußere Einmischung.
Ist es noch von Bedeutung für Chinas Afrikapolitik, dass es nie eine Kolonialmacht war?
Ja, und die Beziehungen Chinas zu Afrika aus der Zeit der Dekolonialisierung sind immer noch wichtig. In der Rhetorik afrikanischer Länder beim Thema China findet man immer wieder Verweise auf die antikolonialen Kämpfe. Es waren auch afrikanische Länder, die sich in der Uno dafür eingesetzt haben, dass dort seit 1971 die Volksrepublik statt Taiwan China repräsentiert. Die erste Reise des Jahres des chinesischen Außenministers führt seit über 30 Jahren immer nach Afrika.
Eric Olander ist Journalist und China-Experte. Er ist mit Cobus van Staden vom South African Institute of International Affairs der Gründer des China Africa Project, einer unabhängigen Medienplattform, die sich mit den verschiedenen Facetten der Beziehung zwischen China und afrikanischen Ländern beschäftigt.