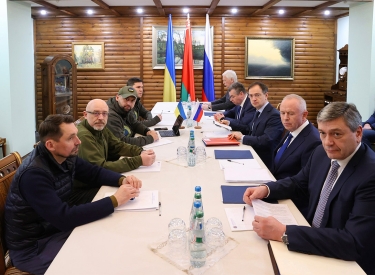Der deutsch-französische Zwist
»Ein deutsch-französischer Krieg wird wieder möglich.« Unter diesen sensationell klingenden Worten publizierte die französische Wirtschaftstageszeitung Les Echos am Donnerstag voriger Woche einen Artikel, dessen Anleser lautete: »Nichts ist gravierender für die Zukunft Frankreichs als das, was derzeit mit Deutschland geschieht. Nichts ist gravierender für die Zukunft Deutschlands als das, was derzeit mit Frankreich geschieht.«
Wer bereits Soldaten mit Pickelhauben aufmarschieren und Schützengräben ausheben sieht, darf sich vorläufig beruhigen. Der Autor des Textes, Jacques Attali, ein früherer Berater mehrerer Präsidenten von François Mitterrand (1981–1995) bis Nicolas Sarkozy (2007–2012), gilt manchen im politischen Establishment als origineller Ideengeber, anderen als mehr oder minder versponnener Exzentriker mit prophetischen Allüren; er hatte den Artikel bereits am Vortag auf seiner Website veröffentlicht. Darin prognostiziert er die Möglichkeit einer ernsthaften Konfrontation zwischen Frankreich und Deutschland, allerdings »bis zum Ende des 21. Jahrhunderts«.
Um den Eindruck einer bilateralen Krise abzuschwächen, reiste Bundeskanzler Olaf Scholz vorige Woche nach Paris, um Staatspräsident Emmanuel Macron zu treffen.
Darüber schrieb Attali nicht zum ersten Mal, vielmehr bemühte er diese rhetorische Figur in den vergangenen beiden Jahrzehnten wiederholt. So rief er bei einer geschichtspolitischen Tagung im Oktober 2018 in den Raum: »Die Jüngsten hier im Saal könnten einen deutsch-französischen Krieg erleben.« Das erzielt immer wieder einen gewissen Effekt. Darüber hinaus versucht Attali aber, tatsächlich vor einem möglichen Bruch des strategischen Bündnisses zu warnen, auf das die stärksten politischen Kräfte in Frankreich seit Jahrzehnten ausgerichtet sind und das ihnen als Rückversicherung gilt, auf dem europäischen Kontinent weiterhin eine wichtige Rolle spielen zu können.
Am Mittwoch voriger Woche sollte die gemeinsame deutsch-französische Kabinettssitzung in Paris stattfinden, eine Veranstaltung, die seit 2003 zunächst halbjährlich, seit 2013/2014 jährlich stattfand, während die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene vertieft wurde. Die gemeinsamen Ministerratssitzungen wurden durch den jährlichen Rhythmus aufgewertet, während manche Angelegenheiten an die Verwaltungsebene delegiert und dadurch stärker entpolitisiert wurden.
In diesem Herbst wurde die Sitzung allerdings zum ersten Mal abgesagt beziehungsweise verschoben, voraussichtlich um ein Vierteljahr. Schwerer wiegt, dass die Absage – eine Woche vor dem geplanten Termin, also am 19. Oktober – just am Vorabend eines zweitägigen EU-Gipfeltreffens in Brüssel stattfand, bei dem es unvermeidlicherweise um Russland und die Ukraine, aber auch um kritische Infrastruktur, Energiepolitik und weitere Fragen von strategischer Bedeutung ging. Die Kernstaaten der Europäischen Union, Frankreich und Deutschland, zeigten dadurch ihre Uneinigkeit unmittelbar vor dem Zusammentreten der Staats- und Regierungschefs.
Der unter anderem zu bilateralen Themen veröffentlichende Publizist Jacques-Pierre Gougeon erklärte dies auf der Website des Forschungsinstituts für Internationale und Strategische Beziehungen (IRIS) zu einem »sehr schlechten politischen Signal« für das deutsch-französische Verhältnis wie für die EU insgesamt. Die Pariser Abendzeitung Le Monde kommentierte die Absage abwägend. Einerseits lasse sich ihre Bedeutung nicht herunterspielen, andererseits gebe es unterschiedliche Herangehensweisen: Auf französischer Seite wolle man keine solchen Treffen abhalten, wenn sich keine gemeinsamen Positionen oder Beschlüsse verkünden ließen, während die deutschen Vertreter dies pragmatischer sähen – auch ohne politische Stellungsnahmen lasse sich an Sachthemen arbeiten.
Um den Eindruck einer bilateralen Krise abzuschwächen, reiste der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz an jenem Mittwoch voriger Woche schließlich allein nach Paris, um Staatspräsident Emmanuel Macron zu treffen. Über den Inhalt des dreistündigen Gesprächs drang wenig nach außen, die französische Seite bezeichnete es als »sehr konstruktiv«, die deutsche als »freundschaftlich«. Macron und Scholz seien sich darin einig gewesen, dass die EU mit einer der schwersten Krisen ihrer Geschichte konfrontiert sei und wichtige Weichen stellen müsse.
Zu den Kernpunkten in den derzeitigen bilateralen Spannungen zählt unter anderem die Rüstungskooperation. Dass die deutsche Regierung die Riesensumme von 100 Milliarden Euro im Rahmen eines von Scholz so bezeichneten »Wumms« als Sondervermögen für die Bundeswehr deklariert hat, um in den kommenden Jahren nachholende Aufrüstung zu betreiben und Militärgüter zu beschaffen, kommentierten die etablierten Medien und staatstragenden Parteien in Frankreich zunächst eher wohlwollend.
Dort hätte man in früheren Jahrzehnten noch Warnungen vor einem Aufleben des deutschen Militarismus vernommen – jedenfalls zu Zeiten, als der Gaullismus noch anders denn als verbleichender Mythos existierte und die Französische Kommunistische Partei noch stark an Mitgliedern und Wählern war. Nunmehr blieben solche Stimmen nahezu gänzlich aus. Vielmehr wurde in staatstragenden Milieus fast unisono die »Rückkehr der deutschen Politik zum Realismus« gelobt.
Diese positive Bewertung wurde in den vergangenen Wochen jedoch in Frage gestellt. Die Bundesrepublik verkündete Beschlüsse zur Rüstungsbeschaffung, bei denen französische und zum Teil auch andere europäische Firmen aus Sicht der Pariser Entscheidungsträger nur ungenügend Beachtung finden. Ein solch stattlicher Geldbatzen, der in Rüstungsanstrengungen gesteckt werden soll, weckt Begehrlichkeiten und Erwartungen auf industrielle Aufträge, die unter anderem französische Unternehmen akquirieren könnten. An der geplanten Raketenabwehr für Osteuropa sollen jedoch neben deutschen eher US-amerikanische und israelische industrielle Partner beteiligt sein. In Paris wies man unwirsch darauf hin, der französische Konzern Thales arbeite seit sieben Jahren in Kooperation mit italienischen Firmen an vergleichbaren Abwehrprojekten.
Bei der Energiepolitik rief es nicht allein in Frankreich, sondern bei vielen EU-Verbündeten geballten Unmut hervor, dass die deutsche Regierung ankündigte, fast 200 Milliarden Euro (den sogenannten Doppelwumms) zur Sicherung insbesondere der Gasversorgung bereitzustellen, ohne sich zuvor mit europäischen Partnern abgestimmt zu haben. Es wird befürchtet, die Bundesrepublik könne dadurch ihre geballte Wirtschaftsmacht ausspielen, um ihre Versorgungssicherheit zu gewährleisten – dabei jedoch Pläne untergraben, durch eine gemeinsame Einkaufspolitik aller 27, notfalls auch nur von 15 EU-Staaten die Preise bei den Rohstoffverkäufern verringern zu können.
Frankreich wiederum zeigte sich Mitte Oktober unkooperativ, was den Verlauf einer von Spanien und Deutschland geplanten Erdgaspipeline betrifft, die durch Südfrankreich verlaufen soll. Frankreich gibt an, bislang ungenügend konsultiert, ja bei der Planung übergangen worden zu sein, und die französische Regierung will von dem Projekt nichts hören. Scholz bekräftigte jedoch bis Oktober seine Unterstützung für das Vorhaben.
Zumindest auf einer Ebene funktioniert die Zusammenarbeit noch: Frankreich stellt Deutschland Erdgas aus seinen eigenen Einkäufen zur Verfügung. Im Gegenzug liefert die Bundesrepublik Strom an Frankreich, wo derzeit rund 30 von insgesamt 56 Atomreaktoren wegen Wartungsarbeiten und Reparaturen stillliegen. Frankreich ist wesentlich weniger von Erdgas abhängig als Deutschland, Gas macht derzeit lediglich drei Prozent seines Primärenergieverbrauchs aus; in Deutschland waren es im vorigen Jahr hingegen knapp 27 Prozent. Frankreichs Erdgasimporte stammten im August zu lediglich neun Prozent aus Russland, vor Beginn des Ukraine-Kriegs waren es maximal 17 Prozent; Macron sagte kürzlich im Fernsehen, nunmehr seien es noch drei Prozent. Deutschland hingegen importierte vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine etwa 55 Prozent des Erdgases aus Russland.
Der deutsch-französische Energieverbund ruft jedoch wachsende Kritik aus der linken wie der rechten Opposition in Frankreich hervor: Es sei widersinnig, einem Land aus der Klemme zu helfen, das sich zuvor selbstverschuldet von russischem Gas dermaßen abhängig gemacht habe wie Deutschland, argumentiert Marine Le Pen. Wird der Mangel im Winter deutlicher spürbar, zum Beispiel in der Industrie, dürfte diese Energiekooperation immer stärker kritisiert werden.