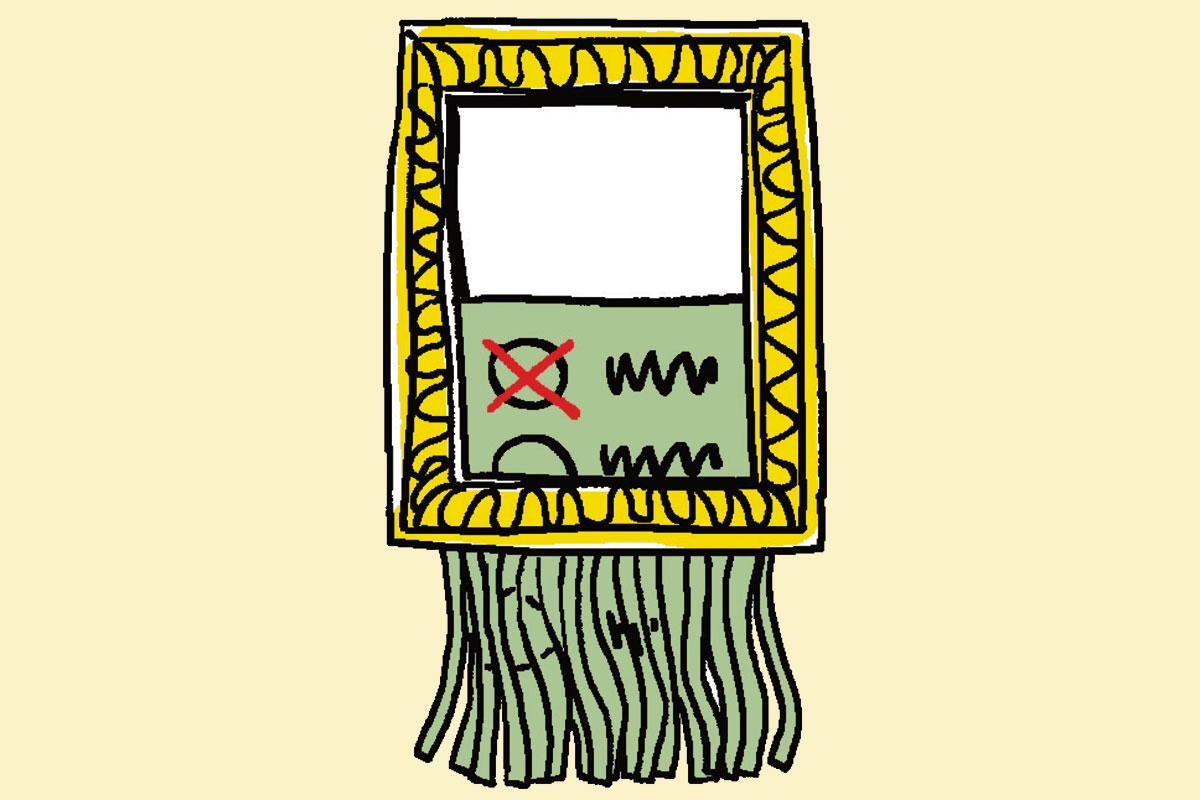Ein Fall für Karlsruhe
Überraschend viele Abgeordnetenplätze im Bundestag waren unbesetzt, als dort am Freitagmittag voriger Woche die Aussprache über die Änderung des Bundeswahlgesetzes stattfand. Für die spätere namentliche Abstimmung kamen noch ein paar Parlamentarier:innen aus der Kantine und ihren Büros, aber 53 der 736 Bundestagsabgeordneten blieben auch dieser fern. Prozentual gesehen glänzte die Fraktion der Linkspartei am meisten mit Abwesenheit: 26 Prozent ihrer Abgeordneten konnten ihre Teilnahme an einer Abstimmung nicht einrichten, in der es um eine der einschneidendsten Veränderungen in der Nachkriegsgeschichte ging.
Bereits seit Jahren war man sich im Bundestag fraktionsübergreifend einig, dass das Wahlsystem reformiert werden müsse. Das bislang geltende Recht mit seinen Überhang- und Ausgleichsmandaten hatte den Bundestag von Wahlperiode zu Wahlperiode immer weiter anwachsen lassen. Wenn eine Partei durch gewonnene Direktmandate mehr Abgeordnete in den Bundestag schicken konnte, als ihr nach ihrem Zweitstimmenanteil zusteht, erhielten die anderen Parteien Ausgleichsmandate, damit im Bundestag das korrekte Verhältnis der Zweitstimmenanteile wieder abgebildet wird. Das hat dazu geführt, dass statt der grundsätzlich vorgesehenen Zahl von 598 Abgeordneten derzeit 736 im Bundestag sitzen. Das ist weniger ein Problem der parlamentarischen Arbeit als vielmehr ein finanzielles, denn auch die 138 zusätzlichen Abgeordneten erhalten Diäten und Zuwendungen für ihren jeweiligen Stab. Laut dem Bund der Steuerzahler würden mit der anstehenden Verkleinerung 340 Millionen Euro pro Legislaturperiode eingespart werden.
Der mit den Stimmen der drei Fraktionen angenommene Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bundestag zukünftig stets 630 Abgeordnete hat.
Weil die sogenannte Große Koalition von Unionsparteien und SPD es in der vergangenen Wahlperiode nicht fertiggebracht hatte, sich auf eine Reform zur Verkleinerung des Bundestags zu einigen, fiel die Ausgestaltung nun der derzeitigen Regierungskoalition von SPD, Grünen und FDP zu. Der mit den Stimmen der drei Fraktionen angenommene Gesetzentwurf sieht vor, dass der Bundestag zukünftig stets 630 Abgeordnete hat. Es bleibt allerdings bei den bisherigen 299 Wahlkreisen.
Bislang galt das Wahlsystem der Bundesrepublik als eine Mischform aus Mehrheits- und Verhältniswahl, künftig dürfte es weitgehend als Verhältniswahl gelten. Denn die Zweitstimme soll weiterhin über die Verteilung der Sitze an die Wahllisten entscheiden, aber nicht mehr alle Gewinner:innen eines Wahlkreises, die mit der einfachen Mehrheit der Erststimmen gewählt wurden, dürften in den Bundestag einziehen. Wahllisten erhalten nur noch so viele Sitze, wie ihnen nach dem Zweitstimmenanteil zustehen. Gewinnen die Kandidat:innen einer Partei mehr Wahlkreise, als sie Sitze gemäß den Zweitstimmen erringt, dann gehen die Wahlkreissieger:innen mit den schlechtesten Ergebnissen leer aus. Das neue Prinzip trägt den Namen Zweitstimmendeckung.
Besonders erzürnt zeigten sich die Fraktionen der Union und der Linkspartei darüber, dass die geplante Streichung der Grundmandatsklausel erst am Montag der vergangenen Woche mit einem geänderten Gesetzentwurf bekanntgegeben worden war.
»Wir schaffen damit ein faires, transparentes, einfaches Wahlrecht«, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, in der Bundestagsdebatte. Das ist mindestens Quatsch, wenn nicht gelogen. Abgeschafft hat man im Rahmen der Reform auch die sogenannte Grundmandatsklausel, nach der Parteien bislang trotz Scheitern an der Fünfprozenthürde in den Bundestag einziehen konnten, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewannen. Die Linkspartei sitzt derzeit überhaupt nur aufgrund dieser Klausel in Fraktionsstärke im Bundestag und auch die CSU überspringt seit zwei Jahrzehnten die Fünfprozenthürde immer knapper, gewann aber bei der Bundestagswahl 2021 in 45 der 46 bayerischen Erststimmenwahlkreise. Nach dem neuen Wahlrecht würde die CSU kein einziges Mandat erhalten, wenn sie nicht bundesweit auf mindestens fünf Prozent der Stimmen kommt – selbst wenn sie alle bayerischen Wahlkreise gewonnen hätte.
Besonders erzürnt zeigten sich die Fraktionen der Union und der Linkspartei darüber, dass die geplante Streichung der Grundmandatsklausel erst am Montag der vergangenen Woche mit einem geänderten Gesetzentwurf bekanntgegeben worden war. CSU, Linkspartei und die bayerische Staatsregierung haben bereits angekündigt, die Verfassungsmäßigkeit der Reform vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Es geht ihnen dabei vor allem um die Abschaffung der Grundmandatsklausel. Aber auch an anderer Stelle könnte das neue Gesetz aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts insbesondere mit dem Wahlgrundsatz der Gleichheit kollidieren. Das neue Wahlsystem lässt nämlich weiterhin Einzelbewerber:innen, die von keiner Partei aufgestellt wurden, in Wahlkreisen zu. Gewinnen diese ihren Wahlkreis, erhalten sie ein Bundestagsmandat – unabhängig davon, wie gut ihr Wahlkreisergebnis war.
Ein Denkexperiment zur Verdeutlichung: Würde also die CSU auf die Aufstellung einer Landesliste verzichten, würden aber ihre Kandidat:innen in den Wahlkreisen als Einzelbewerber direkt antreten und diese gewinnen, dann zögen 46 CSU-Politiker:innen in den Bundestag ein, die sich dann im Rahmen der Koalitionsfreiheit der CDU-Fraktion anschließen könnten. Mit einer Landesliste kann die CSU nach neuem Wahlrecht allerdings nur mit 32 bis 35 Abgeordneten rechnen, gesetzt den Fall, dass sie überhaupt fünf oder mehr Prozent der in ganz Deutschland abgegebenen Stimmen erringt.