Mehr »filthy speech« wagen
Anfang Januar berichtete die New York Times über eine haarsträubende Geschichte: Erika López Prater, Mitglied des Lehrkörpers als sogenannte adjunct professor an der privaten Hamline University in Saint Paul, Minnesota, leitete ein kunsthistorisches Seminar, in dem sie auch eine Malerei aus dem 14. Jahrhundert zeigte.
Das Bild, das dem »Jāmiʿ al-tawārīkh« entnommen ist, der von dem vom Judentum zum Islam konvertierten Rashīd al-Dīn verfassten ersten Weltchronik, zeigt den Propheten Mohammed zusammen mit einem Engel. Unter Kunstwissenschaftlern gilt es als Meisterwerk. Wohlwissend, dass das im Koran nicht direkt ausgesprochene Bilderverbot vor allem orthodoxen Muslimen als unverletzlich gilt, machte Prater nicht nur im Syllabus darauf aufmerksam, dass sie die Malerei im Unterricht zeigen wolle, sondern wies auch in der entsprechenden Sitzung mehrere Male im Sinne einer Triggerwarnung auf das bevorstehende Zeigen des Bilds hin, um den Studentinnen und Studenten die Möglichkeit zu geben, den Raum zu verlassen.
Beleidigung der Religion
Es kam aber anders: Die Studentin Aram Wedatalla, wohl nicht zufällig auch Präsidentin der Vereinigung muslimischer Studenten an der Universität, blieb sitzen – und beschwerte sich anschließend bei der Verwaltung über die Lehrerin. Später beschrieb sie bei einer öffentlichen Veranstaltung unter Tränen, als wie beleidigend sie es ihrer Religion gegenüber empfunden habe, dass das Bild gezeigt wurde. Auch ein Entschuldigungsschreiben Praters konnte nichts mehr retten: Die Universitätsleitung distanzierte sich von ihr – und beendete das Arbeitsverhältnis.
Folgt man der Argumentation des Literaturwissenschaftlers Adrian Daub, ist das Problem an einer solchen Geschichte nicht so sehr, dass sie passiert ist, sondern dass über sie berichtet wurde. Auch in deutschsprachigen Medien wurde Praters Kündigung thematisiert; Die New York Times verzichtete im Text zwar auf den Begriff »Cancel Culture«, selbstredend ist der Vorgang aber genau dieser zuzurechnen und auch so rezipiert worden.
Ronald Reagan konnte die Studentenorganisation in Berkeley ein »filthy speech movement« nur deswegen nennen, weil diese sich selbst als Free Speech Movement bezeichnete.
Daub hält solcherlei Berichterstattung für das Schüren von »moralischer Panik«, die auch im Untertitel des jüngst erschienenen Buchs des in Stanford als Professor lehrenden Autors prominent hervorgehoben wird: »Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst«. In einem Beitrag über das Buch, den das ARD-Magazin »Titel Thesen Temperamente« sendete, bezeichnete Daub die Fälle, für die der von der Hamline University als exemplarisch gelten darf, abwertend als »Anekdoten«, die von Autoren weiterverbreitet würden, die höchstwahrscheinlich vorher noch nie von der Existenz der jeweiligen Universität gehört hätten.
Daubs in »Cancel Culture Transfer« ausgebreitete Grundthese ist simpel und nicht einmal falsch: Die Rhetorik, mit der seit den späten achtziger Jahren, damals angetrieben von US-Präsident Ronald Reagan, über political correctness diskutiert wurde, wiederhole sich jetzt in der Debatte über »Cancel Culture« – und setze sich, so Daub, vor allem in Europa rigoroser durch als damals.
Auch kann er diese harsche Rhetorik bis in die sechziger Jahre zurückverfolgen, als Reagan sich um das Gouverneursamt in Kalifornien bewarb und als eines seiner Kernanliegen angab, »das Chaos in Berkeley zu bereinigen«. An der Universität unweit von San Francisco begehrten nämlich die linken Studentinnen und Studenten auf, was dem konservativen Republikaner und seiner Wählerschaft ein Dorn im Auge war – und sich hervorragend für den Wahlkampf ausschlachten ließ, um tatsächlich moralische Panik zu schüren.
Was Daub allerdings wegen seiner etwas manisch anmutenden Fixierung auf die Republikaner entgeht, ist, dass Reagan die Studentenorganisation in Berkeley ein »filthy speech movement« nur deswegen nennen konnte, weil diese sich selbst als Free Speech Movement bezeichnete. Heutzutage klingt das anrüchig und nach einer typisch rechten Sache, aber tatsächlich waren es in den sechziger Jahren die linken Studenten, die sich die freie Rede auf die Fahnen schrieben.
Moralische Panik kennt keine politische Gesinnung mehr
Wenn Daub dann aus einer lächerlichen Rede Reagans zitiert, in der er eine Party von Gegnern des Vietnam-Kriegs beschreibt und ausbreitet, dass dort nicht nur Filmaufnahmen von nackten, sich sinnlich bewegenden Menschen gezeigt wurden, sondern auch den durch das Gebäude wehenden Geruch von Marihuana hervorhebt, dann kann man sich des Gedankens nicht erwehren, dass sich heutzutage wohl nicht nur die rechten Republikaner oder christliche Fundamentalisten darüber echauffieren würden, sondern auch manche woke Linke, bei denen Laszivität verpönt ist und ein neuer Puritanismus herrscht. Moralische Panik an sich kennt zumindest heutzutage prinzipiell keine politische Gesinnung mehr, sondern hat alle Milieus erfasst – und sie unterschiedlich stark verroht.
Blinde Flecken lassen sich bei Daub zuhauf finden, zum Beispiel wenn er ausführt, der Begriff der »political correctness« stamme ursprünglich aus der Kommunistischen Partei der USA, in der man sich mit ihm sarkastisch über allzu parteilinientreue Mitglieder lustig machte. Nur ein paar Seiten später schreibt Daub dann aber, der Ausdruck »politische Korrektheit« sei »eine rechte Erfindung«. Ja, was denn nun? Dasselbe Spiel mit der »Cancel Culture«: Diese und ihre begriffliche Vorgängerin, die »call-out culture«, sind nämlich ebenfalls keine rechten, sondern linke Begriffsschöpfungen, wie Daub selbst darlegt: Sie wurden zuerst auf »Black Twitter« benutzt, einer Twitter-Blase aus jungen, progressiven Afroamerikanern.
Der erste Adressat eines call-out war übrigens wenig überraschend kein rechter Politiker, sondern niemand Geringeres als der durch und durch linksliberale Late-Night-Moderator Stephen Colbert. An dieser Tatsache ließe sich etwas lernen, doch Daub beharrt auf seiner These, dass das »Canceln«, solange es von linker Seite kam, immer eine ironische Komponente gehabt habe, einfach ein Ausdruck enttäuschter Fans ohne wirkliche Konsequenz sei, ein »Eingeständnis der eigenen Machtlosigkeit«, während Rechte das mit der »Cancel Culture« todernst nähmen.
In Daubs Diskursanalyse ist für Positionen, Haltungen, Ideen und Kritik kein Platz
Anscheinend hat Daub nie von Natalie Wynn gehört, der Transfrau, die unter dem Namen ContraPoints philosophische Videos bei Youtube hochlädt, eigentlich ein Star des Trans-Aktivismus ist, sich 2019 aber dazu genötigt sah, ihren Twitter-Account für eine Woche zu deaktivieren, nachdem sie dort ausgeführt hatte, dass sie als Transfrau es problematisch findet, in »hyperwoke spaces« andauernd ihre Pronomen verkünden zu müssen – und für diese nachvollziehbare Unmutsäußerung von anderen Trans-Aktivisten wüst beschimpft wurde. Wynn zumindest hatte ein Jahr später, als sie ein Video über diese Geschichte veröffentlichte, kein Problem damit, das, was ihr passiert war, als »Cancel Culture« zu bezeichnen – und diese eben nicht als Kinderei oder Ausdruck von Machtlosigkeit zu verniedlichen, wie Daub es tut. Eine Rechte ist sie deswegen noch lange nicht.
Anstatt sich der »Cancel Culture« als einem politischen Phänomen mit echten agierenden Menschen und echten Opfern politisch zu widmen, flüchtet sich Daub, ganz der Professor, in literaturwissenschaftliche Abhandlungen und schreibt ein Kapitel über den Campusroman und ein anderes über die Anekdote, in denen er allzu beflissen versucht, aus dem politischen Phänomen ein diskursives zu fabrizieren – und es damit entpolitisiert. In seiner Diskursanalyse, die sich allerdings im Wesentlichen darauf beschränkt aufzuzählen, wie oft beispielsweise das Wort »Cancel Culture« in Zeitungen benutzt wurde, um zu beweisen, dass das Thema überbetont werde, ist für Positionen, Haltungen, Ideen und Kritik kein Platz.
Es gibt immer nur einen monströsen Diskurs, die Gesamtheit von dem, was gesprochen wird – was da allerdings genau gesagt wird, fällt unter den Tisch. Wenn Daub beispielsweise berichtet, dass der Begriff »Cancel Culture« im Magazin Spiegel in gut 200 Artikeln auftaucht, ist das eine Aussage allein über die Quantität der Texte, nicht aber über deren Qualität, wobei man beim Spiegel davon ausgehen darf, dass in vielen der Texte, in denen der Begriff vorkommt, er ganz im Sinne Daubs kritisiert wird. Und, um auf das Beispiel aus der New York Times zurückzukommen: Ist die Berichterstattung Teil der beschworenen moralischen Panik, obwohl in ihr nicht von »Cancel Culture« die Rede ist?
Die schiere Masse aber ist das, was Daub wohl Sorgen macht, obwohl man genauso argumentieren könnte, dass die Debatte davon profitiert, wenn mehr diskutiert wird. Dass Daub die ganze Zeit das Wort »Diskurs« im Mund führen will, scheint auch eine déformation professionnelle des Hochschulprofessors zu sein: Auf gefühlt jeder Seite kommt es mindestens ein Mal vor, und wenn man auf einer Seite mal nichts über das »diskursive Grundvertrauen«, die »Diskursform« oder die »diskursive Explosion« erfährt, darf man sich sicher sein, dass auf der Seite darauf gleich mehrfach von den »Diskursen« die Rede sein wird. Daub gibt sich damit zufrieden, eine Diskursgeschichte zu schreiben – eine politische Analyse der culture wars und all ihrer Beteiligten wäre wichtiger gewesen.
Wenn man auf einer Seite des Buchs mal nichts über das »diskursive Grundvertrauen«, die »Diskursform« oder die »diskursive Explosion« erfährt, darf man sich sicher sein, dass auf der Seite darauf gleich mehrfach von den »Diskursen« die Rede sein wird.
Mit einer Sache hat Daub uneingeschränkt recht: Wenn in der Debatte über »Cancel Culture« ständig das »Ende der Demokratie« ausgerufen wird oder beispielsweise ein Don Alphonso von der Welt von der »Cancel-Culture-Seuche« spricht, dann ist das unendlich hysterisch und übertrieben. Reinheitsphantasien wie die des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der 2021 dem Import der woke culture nach Frankreich den Kampf ansagte, sind albern, auch deswegen, weil das, was derzeit an Theorie aus den USA kommt, meist selbst schlecht verdaute und wieder ausgespuckte Happen von French theory sind.
Selbst urlinke Forderungen können als »problematisch« gelten
Das sollte aber niemanden daran hindern, Kritik an der »Cancel Culture« zu äußern, die nicht marktschreierisch ist – denn solch eine Kritik ist bitter nötig. Zwar mag das Aufbauschen einzelner kleiner Geschichten aus US-Colleges ermüden, doch sieht man sie sich genauer an, ergeben sie ein großes Bild. In diesem wissen vor allem auch Linke immer weniger, was sie sagen können, ohne einen Shitstorm loszutreten, weil mittlerweile selbst urlinke Forderungen als »problematisch« gelten können; und Menschen werden prinzipiell um Erfahrungen gebracht, weil sie sich mit teils willkürlich inkriminierten Texten, Büchern, Filmen, Ideen erst gar nicht mehr beschäftigen.
Derlei könnte man tatsächlich als illiberale Konsequenzen einer moralischen Panik kritisieren, doch Daub sieht eine solche nicht bei der »Cancel Culture« selbst am Werk, sondern im Kampf gegen sie. Vielleicht stimmt beides bis zu einem gewissen Grad. Aber dem im akademischen Betrieb vor allem von sich selbst progressiv Dünkenden losgetretenen Illiberalismus müsste man eben mit mehr Debatte, wenn es sein muss mit mehr »Diskurs«, kurz: mit mehr der von Reagan gehassten »filthy speech« beikommen, anstatt zu tun, als gäbe es ihn gar nicht – damit nicht mehr auf Twitter-Accounts mit starker Reichweite oder von Professoren mit Hang zum Subversiven entschieden wird, was moralisches Fehlverhalten ist und was nicht.
Es gäbe aber noch eine andere Möglichkeit, nämlich eine coole, nonchalante, die Daub sogar selbst im Interview mit »Titel Thesen Temperamente« ansprach: »Kritisches Ignorieren, einfach mal sein lassen, einfach mal links liegen lassen, ist äußerst wichtig.« Recht hat er. Man darf hoffen, dass er dies nicht nur an zur Hysterie neigende Rechte richtet, sondern auch seinen Studenten in Stanford diesen Tipp gibt.
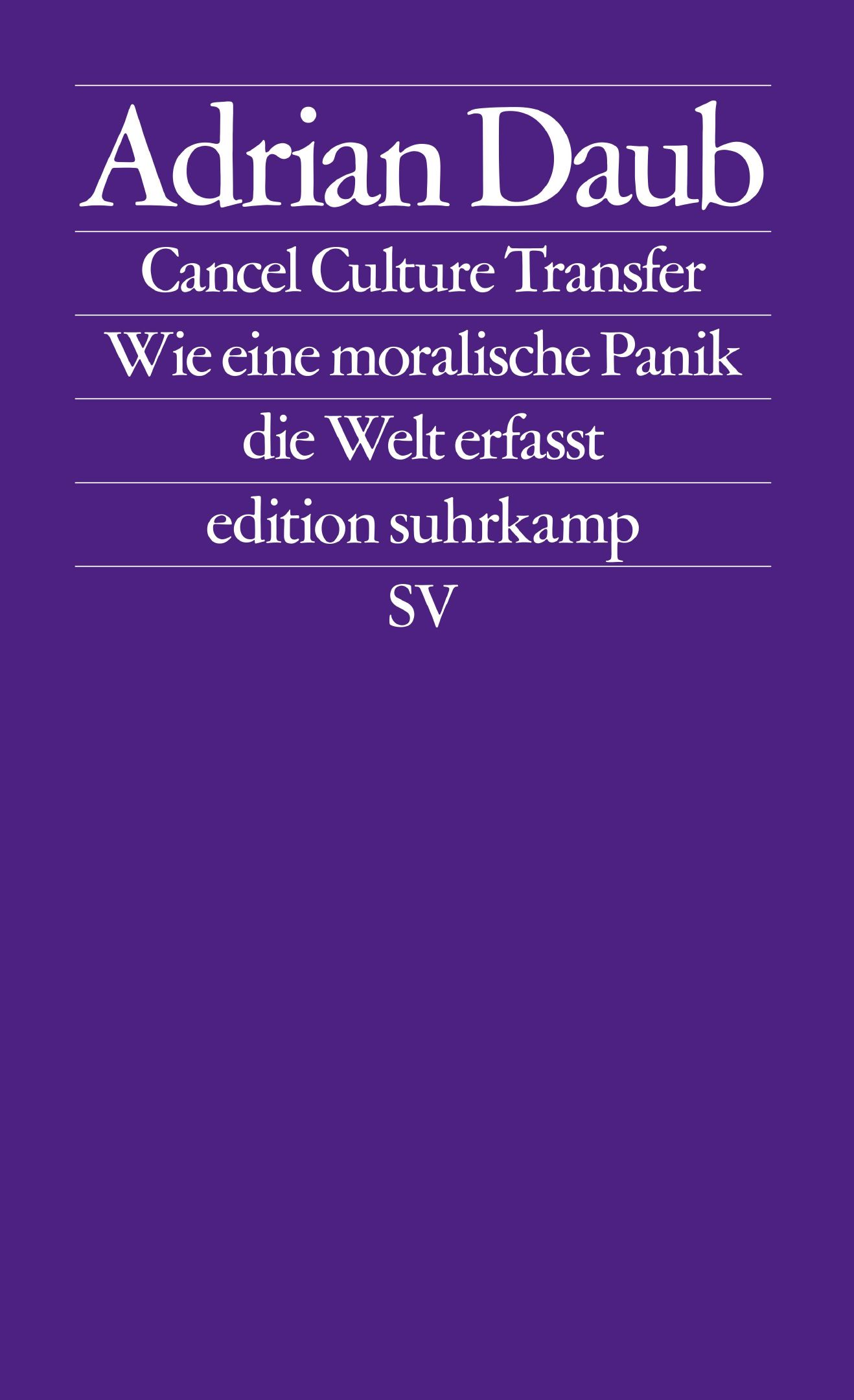
Adrian Daub: Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Suhrkamp, Berlin 2022, 371 Seiten, 20 Euro












