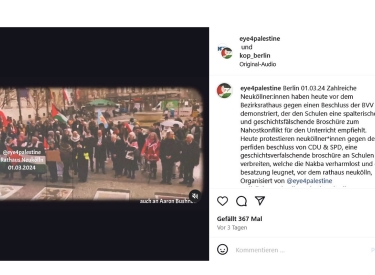Feste Stellen für die Demokratie
Seit einigen Wochen ist die Auseinandersetzung um das »Demokratiefördergesetz« wieder deutlich intensiver geworden. Das geplante Gesetz soll die staatliche Förderung zivilgesellschaftlicher Projekte gegen Rassismus, Antisemitismus und andere menschenfeindliche Hassideologien langfristig festschreiben. Die geförderten Initiativen könnten dadurch auf lange Sicht planen, statt ihren Mitarbeitern nur befristete Projektstellen anzubieten. 200 Millionen Euro gibt der Bund dieses Jahr für die Demokratieförderung aus.
Ende Februar fand eine Anhörung im zuständigen Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Bundestags statt. Fast gleichzeitig erschien ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zum Gesetzentwurf. Vor allem auf Letzteres bezogen sich seitdem mehrere Kommentare aus der liberal- bis rechtskonservativen Publizistik. Sie diagnostizieren mit Befriedigung einen »Rückschlag« für die Regierungspläne, da das Gutachten die Verfassungsmäßigkeit des Entwurfs anzweifele.
Die Abhängigkeit von staatlicher Förderung könnte dazu führen, dass sich zivilgesellschaftliche Initiativen zukünftig mit allzu radikaler Staatskritik eher zurückhalten – eine Beißhemmung gegenüber der fütternden Hand sozusagen.
In der Tat leiten die Wissenschaftlichen Dienste vor allem aus Erörterungen des Verfassungsrechtlers Christoph Möllers ab, dass eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes wahrscheinlich fehle, da die Ziele des Demokratiefördergesetzes auch »durch Selbstkoordination der Länder« erreicht werden könnten. Ein Blick in das Gutachten zeigt, dass die Wissenschaftlichen Dienste sich hier in einer Frage positionieren, zu der es widerstreitende Rechtsauffassungen gibt. Die Anwältin und Expertin für öffentliches Recht Eva Ricarda Lautsch wirft dem Gutachten auf dem juristischen Portal Legal Tribune Online vor, »zumindest unsauber und in wesentlichen Teilen unvollständig« zu argumentieren. Als Folge drohe »eine Diskussion über Gesetzgebungskompetenzen, bei der die Bruchlinie der juristischen Expertenmeinungen auf wundersame Weise genau entlang der politischen Konfliktlinie verläuft«.
Tatsächlich geht es den aufgescheuchten Kommentaren aus dem rechts- beziehungsweise konservativ-liberalen Lager eigentlich um etwas ganz anderes. Das zeigen Formulierungen wie »der woke Plan einer übergriffigen Regierung« (Focus). Harald Martenstein verstieg sich in der Welt gar zu der Behauptung, mit dem Gesetz solle der »Linksradikalismus« durch Maßnahmen »zugunsten regierungsnaher, zum Teil am linken Rand befindlicher Organisationen mit Staatsknete gepampert werden«; der »autoritäre, repressive Staat« vollziehe damit ein Comeback. Was von solch hart an der Grenze zu rechtspopulistischem Verschwörungsdenken entlangschrammendem Geraune zu halten ist, hat Felix Klopotek an dieser Stelle bereits vor einigen Monaten dargelegt.
»Täter-Opfer-Umkehr« durch islamistische Akteure
Doch gibt es auch jenseits vom »konservativ-populistischen Aufschrei« (Klopotek) durchaus ernstzunehmende Einwände gegen den auch von ihm kritisierten »staatlichen Zugriff auf politisch-gesellschaftliche Gruppen«. Die Abhängigkeit von staatlicher Förderung könnte dazu führen, dass sich zivilgesellschaftliche Initiativen zukünftig mit allzu radikaler Staatskritik eher zurückhalten – eine Beißhemmung gegenüber der fütternden Hand sozusagen.
Aus dezidiert liberaler Perspektive hält Ijoma Mangold in der Zeit fest, das geplante Gesetz treibe »den Schulterschluss zwischen Regierung und Nichtregierungsorganisationen stärker voran, als es für die urliberale Trennung von Staat und Gesellschaft bekömmlich ist.«
Nun droht durch den von Jugendministerin Lisa Paus (Grüne) und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vorangetriebenen Gesetzentwurf sicher keine umfassende Verstaatlichung oder Regierungslenkung der deutschen NGOs, auch wenn manche Äußerungen Faesers durchaus einen autoritären Gestus verströmen. »Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen«, ließ sie sich mit Blick auf Rechtsextremismusbekämpfung und das geplante Gesetz vernehmen – den Satz hätte genauso gut ein Unionspolitiker gegen allzu aufmüpfige linke Gruppen richten können.
Es gibt aber noch andere Einwände gegen den Gesetzentwurf. Einige formulierte in der Ausschussanhörung Ali Ertan Toprak, der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschlands (KGD). Die Unionsfraktion hatte ihn als Sachverständigen geladen. Im Entwurf wird auch die Bekämpfung von »Islam- und Muslimfeindlichkeit« als Ziel ausgegeben. Toprak befürchtet, dass »die jahrelange schlechte Praxis hier zum Gesetz gemacht« werde. Es habe nämlich in der Vergangenheit »eine ideologische Förderung« stattgefunden. Als zum Beispiel die KGD dem Bundesfamilienministerium ein Projekt »gegen Nationalismus und Antisemitismus in Migrantencommunitys« vorgeschlagen habe, sei dieses abgelehnt worden mit der Begründung, die KGD solle doch besser etwas gegen Rechtsextremismus machen.
Es sei ein Unding, so Toprak, dass beispielsweise die regierungsnahe türkische Bewegung Millî Görüş von dem Demokratiefördergesetz profitieren könnte, oder auch die Ditib – der größte deutsche Moscheeverband, der im Grunde ein verlängerter Arm der türkischen Religionsbehörde Diyanet und damit des Erdoğan-Regimes ist. Zu Recht wies Toprak darauf hin, dass diese und andere islamistische Akteure mit Nähe zu entsprechenden Regimes seit Jahren »Täter-Opfer-Umkehr« betrieben, indem sie »liberalen Muslimen, orientalischen Christen, Aleviten und Yeziden eine Mitschuld an Islamfeindlichkeit« zuwiesen.
»Extremismusklausel hilft überhaupt nicht«
Damit benennt er ein Problem, auf das auch andere liberale Muslime wie Eren Güvercin und Murat Kayman von der Alhambra-Gesellschaft seit Jahren regelmäßig hinweisen, ebenso wie etwa die kurdisch-yezidische Menschenrechtlerin Düzen Tekkal mit ihrer Organisation Háwar Help. Sie alle waren in der Vergangenheit Ziele islamistischer Hetzkampagnen. Das Problem dürfte sich derzeit aufgrund ihrer israelsolidarischen Haltung noch verschärft haben. Erst recht gilt das für den ebenfalls von der Union zu der Anhörung geladenen Psychologen Ahmad Mansour.
Allerdings plädieren Toprak und Mansour auch ganz im Sinne von CDU, CSU und FDP für die sogenannte Extremismusklausel, die sicherstellen soll, dass staatliche Fördergelder nur an Vereine gehen, die sich zum Grundgesetz bekennen. Die Klausel wurde aus guten Gründen vor zehn Jahren von der großen Koalition abgeschafft: Sie stellte eine Gewissensprüfung dar und traf vor allem linke Gruppen, die sich gegen Rechtsextremismus engagierten.
Der von den Grünen geladene Antisemitismusforscher Lars Rensmann äußerte bei der Anhörung Verständnis für die »Sorgen meiner sehr geschätzten Kollegen Herrn Mansour und Ali Ertan Toprak«. Auch bestätigte er die von Toprak angesprochenen Fälle und kritisierte ebenfalls, dass Organisationen wie Ditib staatliche Förderung erhalten. Doch die Erfahrung zeige, dass »so eine Extremismusklausel hier überhaupt nicht hilft«. Sie sei ein »vollkommen ungeeignetes, verfassungsrechtlich problematisches, bürokratisch problematisches, wegen dem Generalverdacht problematisches Mittel. Ein Mittel, das nicht greift.«
Es sei ein Unding, dass Millî Görüş oder Ditib vom Demokratiefördergesetz profitieren könnten, sagte Ali Ertan Toprak von der Kurdischen Gemeinde Deutschland.
Rensmann unterstützte damit die Auffassung der meisten zur Ausschusssitzung geladenen NGO-Vertreter:innen. Zu diesen gehörte auch Robert Kusche vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e. V., geladen von der Linkspartei, und der von der SPD geladene Geschäftsführer der Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS), Timo Reinfrank.
Gerade Letztere richtet ihre Arbeit gleichermaßen gegen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus, egal ob diese von rechten, islamistischen oder linksradikalen Kreisen ausgehen, und ist deshalb seit Jahren Anfeindungen aus allen diesen Lagern ausgesetzt. Erst vor kurzem forderten linke Antizionisten in einer Social-Media-Kampagne den Ausschluss der »rassistischen« AAS aus allen linken Zusammenhängen.
In der Anhörung beschuldigte Toprak leider auch recht undifferenziert die Vereine Inssan und Ufuq gleichermaßen, den Islamismus zu verharmlosen. Inssan e. V. wird seit langem eine Nähe zur islamistischen Muslimbruderschaft vorgeworfen. Ufuq dagegen ist aus säkularen zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen entstanden, aus Initiativen antirassistischer Jugendarbeit und Islamismus- und Antisemitismusprävention. Sicher lässt sich über Ufuqs pädagogische Konzepte trefflich streiten, aber das gilt auch für die Positionen von Ahmad Mansour, ohne dass dies auch nur einen der diffamierenden Angriffe auf ihn rechtfertigte. Gerade vor dem Hintergrund der rechten Angriffe auf das Demokratiefördergesetz helfen solche polemischen Pauschalisierungen nicht dabei, die Debatte zu versachlichen.