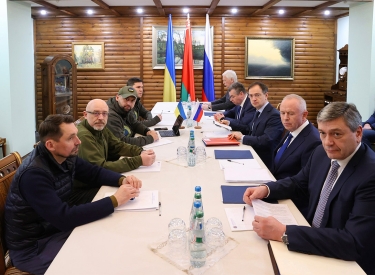Rechtspopulistin versus Linkspopulist
Beim ersten Fernsehduell zwischen Keiko Fujimori und Pedro Castillo Anfang Mai versuchte die Tochter des ehemaligen Diktators Alberto Fujimori ihren Kontrahenten um die Präsidentschaft immer wieder in die Ecke des Sendero Luminoso, der maoistischen Guerillaorganisation Leuchtender Pfad, zu stellen. Am 30. Mai beim Fernsehduell an der Universität von Arequipa, eine Woche vor der Stichwahl, verzichteten beide weitgehend auf polemische Angriffe. Sie warben eher für das eigene Programm, während das jüngste Massaker in der peruanischen Kokaanbauregion, deren Name mit VRAEM abgekürzt wird, kaum eine Rolle spielte.
Dort waren am vorvergangenen Sonntag 16 Menschen ermordet worden. Die peruanischen Behörden machen dafür eine Abspaltung des Sendero Luminoso verantwortlich, die dort am Kokaanbau, -weiterverarbeitung und -schmuggel beteiligt ist. Vereinzelt wurde daraufhin in Presseartikeln darüber spekuliert, ob der bekennende Marxist Pedro Castillo etwas mit der Guerillaorganisation zu tun haben könnte, die in den achtziger und neunziger Jahren mehrere Regionen Perus unter ihrer Kontrolle hatte und einen überaus blutigen Krieg gegen die Regierung in Lima führte. Dort regierte ab 1990 Alberto Fujimori, der auf den Terror des Sendero Luminoso mit staatlichem Gegenterror reagierte und derzeit eine 25jährige Haftstrafe wegen Menschenrechtsverletzungen und Korruption absitzt.
Das würde seine Tochter Keiko, die einst ihren Vater als First Lady bei offiziellen Empfängen begleitete, gern ändern. Die Begnadigung des Diktators Fujimori, der sich derzeit in Lima wegen der Zwangssterilisierung von Tausenden indigenen Frauen vor Gericht verantworten muss, gehört ebenso zu ihrem Programm wie die Aufstockung der Polizei, mit der die Kandidatin den vielen Raubüberfällen Einhalt gebieten möchte. Typische Themen für die 45jährige Politikerin, die mit Fuerza Popular die über Jahre stärkste Partei Perus aufgebaut hat und bereits zweimal erfolglos bei Präsidentschaftswahlen kandidierte. 2011 verlor sie knapp gegen Ollanta Humala, 2016 noch knapper gegen den Wirtschaftsliberalen Pedro Pablo Kuczynski. Beide gelten als korrupt, weil sie vom brasilianischen Odebrecht-Konzern prall gefüllte Umschläge entgegengenommen hatten; Kuczynski musste deswegen im Frühjahr 2018 zurücktreten.
Treibende Kraft im Parlament, das dem Präsidenten letztlich das Vertrauen entzog, war Keiko Fujimori. Auch gegen sie wurde damals bereits ermittelt: wegen illegaler Wahlkampffinanzierung durch den Odebrecht-Baukonzern. Etliche Monate saß sie in Untersuchungshaft, die Beweise seien dem Parlamentarier und linken Umweltschützer Marco Arana zufolge erdrückend. Doch freigelassen wurde Fujimori trotzdem, und solange sie nicht verurteilt ist, darf sie kandidieren.
Das galt nicht nur für die polarisierende Rechtspopulistin, sondern für sechs der 18 Kandidatinnen und Kandidaten im ersten Wahlgang zur peruanischen Präsidentschaft. Das sei »Teil der politischen Krise, die bei uns bereits zum Alltag gehört«, sagt Carlos Monge. Für den Lateinamerika-Koordinator des Natural Resource Governance Institute in Lima, das sich für einen transparenten und effektiven Umgang mit Ressourcen engagiert, ist Pedro Castillo ein Nutznießer genau dieser Krise: »Deutlich über 40 Prozent der Wähler haben radikal gewählt und damit auch für diese Konstellation im zweiten Wahlgang gesorgt«, meint er.
Keiko Fujimori aber darf als etabliert gelten; ihr lasten viele die Schwächung der demokratischen Strukturen in den vergangenen Jahren an, der Anteil der antifujimoristas liegt Analysten zufolge zwischen 30 und 45 Prozent der Wahlberechtigten. Vor allem diese haben Pedro Castillo gewählt, der sich von den bekannten Berufspolitikern distanziert. Der 51jährige Grundschullehrer und Gewerkschafter propagierte im Wahlkampf die Verstaatlichung des Erdöl- und Erdgassektors, in seinem Wahlprogramm taucht die Förderung der Landwirtschaft ebenso auf wie der Umweltschutz und Förderung der Bildung.
Castillo, in der rund 700 Kilometer nördlich von Lima gelegenen Provinzstadt Cajamarca geboren, ist vor allem in den Dörfern auf dem Land populär; dort ist die Lehrergewerkschaft Sutep, deren Generalsekretär er ist, gut verankert. Im ersten Wahlgang holte Castillo mit 19,1 Prozent der Stimmen ein Ergebnis, das ihm kaum jemand zugetraut hatte. In 16 der 24 Regionen Perus lag Castillo vorne, davon in drei mit absoluter Mehrheit. Beim ersten Wahlgang habe Castillo die mobilisieren können, die sich schon lange nicht mehr gehört fühlen, meint Salomón Lerner Febres, ein peruanischer Menschenrechtler: »Die schlechtbezahlten Lehrer in den ländlichen Regionen, aber auch viele einfache Bauern, die von der Politik lange nicht beachtet wurden.«
Diese halten ihrem Kandidaten die Treue, der in vielen peruanischen Medien als Kommunist dargestellt wird, der als Präsident die Wirtschaft des Landes in die Krise treiben werde. Davor warnen vor allem die konservativen Kreise, die mittlerweile recht geschlossen hinter Keiko Fujimori stehen. Allerdings hat es Castillo in den vergangenen Wochen geschafft, sich mit der indigenen Minderheit neue Wählerschichten zu erschließen. In einer 13 Punkte umfassenden Erklärung kündigt er einen neuen verfassunggebenden Prozess an, der Peru wie die Nachbarländer Ecuador und Bolivien zu einem »plurinationalen« und »plurikulturellen« Staat transformieren soll, um die allgegenwärtige Diskriminierung der indigenen Minderheit zu bekämpfen. Die Erklärung könnte Castillo, der derzeit je nach Meinungsforschungsinstitut mit zwei bis sieben Prozent vor Keiko Fujimori liegt, weitere Wählerstimmen bringen.
Castillo hat der Zeitung El Pais zufolge auch vorgeschlagen, das Verfassungsgericht zu entmachten, um die Verfassung von 1993 durch eine neue zu ersetzen, und, falls er an die Macht komme, die Medien zu regulieren, um »dem Schrottfernsehen ein Ende zu setzen«; zudem hat er sich gegen Abtreibung und die Homo-Ehe ausgesprochen.
Immerhin haben sich Castillo und Fujimori auf die Achtung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten verpflichtet und dazu ein Dokument unterzeichnet, das auf Initiative der peruanischen Bischofskonferenz zurückgeht. Nicht nur die treibt die Sorge um, dass ein Rückfall in autokratische Herrschaft drohen könnte.