»Die Entkriminalisierung wird schwierig«
Ihr Buch zu reproduktiven Rechten ist dieses Jahr erschienen, in einer Zeit, in der international viel passiert, sowohl Positives als auch Negatives. Können Sie international eine Tendenz ausmachen, in welche Richtung es geht?
Eine Tendenz ist tatsächlich nur schwer auszumachen. In Deutschland wurde im Juni endlich der Paragraph 219a abgeschafft, der Ärztinnen und Ärzten verboten hat, über Abtreibungen zu informieren. Mehr und mehr Menschen in politischer Verantwortung verstehen, wie fundamental wichtig reproduktive Rechte sind und dass dabei verschiedene Lebensumstände zusammengedacht werden müssen. In Spanien sollen zum Beispiel demnächst dank einer neuen Initiative der linken Regierung bereits 16jährige selbst über eine Abtreibung entscheiden können, und dasselbe Gesetz sieht vor, dass man sich wegen starker Regelschmerzen krankschreiben lassen kann. Gleichzeitig gibt es heftige Rückschläge wie in Polen, wo das ohnehin strenge Abtreibungsrecht nochmal verschärft worden ist und die Regierung will, dass sich Schwangere registrieren lassen. Die ungarische Regierung hat ein Dekret erlassen, nach dem ungewollt Schwangere sich seit Mitte September die Vitalfunktionen des Fötus anhören müssen, bevor sie abtreiben können. In Chile ist Anfang September die neue Verfassung, die unter anderem ein Recht auf Abtreibung vorsah, in einem Referendum abgelehnt worden. Dass der Supreme Court in den USA mit der Aufhebung von »Roe v. Wade« das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche tatsächlich gekippt hat, ist eine wirklich besorgniserregende Entwicklung, von der zudem große Strahlkraft ausgeht.
»Es wäre gut, wenn die Pro-Choice-Bewegung reproduktive Rechte breit als Gesundheitsthema in die Debatte bringt.«
Die Aufhebung von »Roe v. Wade« ist ja ein Erfolg der US-amerikanischen »Lebensschutz«-Bewegung. Beobachten Sie Auswirkungen davon auf die Bewegungen anderer Länder, zum Beispiel in Deutschland, wo am 17. September der bundesweite »Marsch für das Leben« stattfand?
Der Marsch war in diesem Jahr deutlich kleiner als vor der Coronapandemie – da hat auch das Erfolgserlebnis der Anti-Choice-Bewegung in den USA nichts geholfen. Das ist aber kein Anlass, sich beruhigt zurückzulehnen: Die religiöse Rechte ist international extrem gut vernetzt. Zudem treffen sich verschiedene Strömungen wie die extreme Rechte, die Neue Rechte, die christliche Rechte und Konservative auf diesem Feld des Kampfs gegen die Selbstbestimmung und haben auch keine Berührungsängste. Das macht sie enorm einflussreich, auch in Deutschland und auf EU-Ebene. Dafür brauchen sie auch keine Mehrheiten zu gewinnen: In den USA war die Mehrheit der Bevölkerung für das Recht auf Abtreibung, trotzdem ist diese Mehrheit am Supreme Court zustande gekommen und hat »Roe v. Wade« gekippt. Das zeigt, wie einflussreich diese Minderheiten werden können und wie gefährlich das ist.
Sie sagen, es gebe keine Berührungsängste zwischen den verschieden rechten Strömungen. Aber trifft das überall zu? Bei dem Berliner »Marsch für das Leben« betont der veranstaltende Bundesverband Lebensrecht, er werde nur fälschlicherweise »in die rechte Ecke« gestellt. Die »Lebensschützer« versuchen, sich als Vertreter christlicher Nächstenliebe darzustellen, die beispielsweise 2015 dafür waren, Geflüchtete aufzunehmen, aber eben auch für eine »Willkommenskultur für Ungeborene« eintreten.
Es stimmt schon, dass es auch Abgrenzungsbekundungen gibt. Das ist aber in erster Linie strategisch. Auch die AfD fordert schließlich eine »Willkommenskultur für Kinder« in ihrem Parteiprogramm. Und es gibt im Lager der sogenannten Lebensschützer Gruppen, die ganz klar nationalistisch und menschenverachtend auftreten, trotzdem aber auf diesen Märschen willkommen sind. Auch dieses Jahr zum Beispiel wurde eine Person mit einem T-Shirt geduldet, auf dem »Babycaust« stand – und so ganz klar den Holocaust verharmlost. Es ist also mehr eine verbale Positionierung fürs Image als eine tatsächliche Abgrenzung.
Für eine mögliche Reform des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs (StGB) soll demnächst eine Kommission einberufen werden. Es ist recht unwahrscheinlich, dass das zu einer Abschaffung des Paragraphen 218 führt. Hat sich die deutsche Pro-Choice-Bewegung zu sehr auf die Abschaffung des »Werbeverbots«, den Paragraphen 219a StGB, konzentriert?
Dieses Vorgehen war schon richtig. Immerhin haben wir fünf Jahre über den Paragraphen 219a diskutiert, obwohl es im Prinzip die ganze Zeit eine politische Mehrheit für dessen Abschaffung gab – der SPD war aber zunächst wichtiger, erneut eine Koalition mit der Union einzugehen. Das Parlament und die Öffentlichkeit haben erbittert über die Frage gestritten, ob Ärzte und Ärztinnen über ihre rechtlich zulässige Tätigkeit informieren dürfen. Und das war seit 25 Jahren die erste große Diskussion über das Abtreibungsrecht überhaupt. Das zeigt, wie weit zurück Deutschland da noch ist. Deswegen war es vernünftig, klein anzufangen. Die meisten Leute hatten einfach keine Ahnung von dem Thema; davon, dass Abbrüche überhaupt verboten sind und wie schlecht die Versorgungslage ist. Mittlerweile hat man verschiedene Geschichten gehört: wie belastend die Beratungspflicht ist, wie wenige Ärzte und Ärztinnen Abbrüche machen; das Tabu darum konnte ein bisschen abgebaut werden. Dadurch sind wir jetzt an einem viel besseren Punkt, um über den Paragraphen 218 zu sprechen. Aber die Entkriminalisierung wird trotzdem schwierig, obwohl zwei Parteien der Koalition, SPD und Grüne, die Abschaffung sogar im Wahlprogramm hatten.
Welche Themen jenseits des Paragraphen 218 finden Sie wichtig?
Es wäre gut, wenn die Pro-Choice-Bewegung reproduktive Rechte breit als Gesundheitsthema in die Debatte bringt: das Recht auf gut begleitete Schwangerschaft und Geburt, das Recht auf gute kostenlose Verhütungsmittel, sexuelle und reproduktive Rechte für Menschen mit Behinderung, Rassismus im Gesundheitswesen, um nur ein paar Punkte zu nennen.
Sie machen in Ihrem Buch auch Fragen der Bevölkerungspolitik stark, die im heutigen Feminismus kaum mehr diskutiert werden. Dabei ist die Frage, wer welche Kinder bekommen soll und wer eben nicht, weiterhin umkämpft und wird heutzutage nicht nur über Sterilisierungen geregelt, sondern auch über so harmlos erscheinende Maßnahmen wie Kindergeld.
Menschen, die Hartz IV bekommen, wird das angerechnet, obwohl sie das offensichtlich am besten gebrauchen könnten. Wir fordern kostenlose Verhütungsmittel, müssen dabei aber sehr aufpassen, dass das nicht so ausgelegt werden kann, als würden wir ärmeren Menschen nahelegen, zum Wohl der Gesellschaft keine Kinder zu bekommen. Das verbietet sich sowieso, aber wegen der gewaltvollen Geschichte von Bevölkerungspolitik nochmal besonders. Nicht nur die Kostenlosigkeit von Verhütungsmitteln, sondern auch eine freie Wahl ist wichtig.
Ganz deutlich sieht man das im Globalen Süden: Die Programme aus dem Globalen Norden zielen fast immer nur auf Frauen, angeboten werden ihnen meist nur langfristig wirkende Verhütungsmittel wie Implantate, die vergleichsweise schwere Nebenwirkungen haben und nicht selbst entfernt werden können. Das Ziel ist oft nicht, den Leuten eine selbstbestimmte Familienplanung zu ermöglichen, sondern dass sie weniger Kinder bekommen. Das soll dann beispielsweise der Armutsbekämpfung dienen. Dabei sind Kinder nicht das Problem, sondern die ungerechte Verteilung von Reichtum, Turbokapitalismus, die Ausbeutung des Südens für den Norden. Das nicht stärker kritisiert zu haben, ist sicherlich auch ein Versäumnis der weißen Frauenbewegung im Norden.
Ist reproduktive Gerechtigkeit auch eine Art Utopie statt nur eine realpolitische Forderung?
Ja klar, im Kapitalismus ist das so nicht umsetzbar, die Verhältnisse müssen grundlegend umgeworfen werden, um das zu erreichen. Selbstbestimmung in Ungleichheits- und Ausbeutungsverhältnissen funktioniert nur bedingt. Zum Beispiel sollte niemand eine Schwangerschaft aus finanziellen Nöten abbrechen müssen. Gleichzeitig muss es aber möglich sein, solange es diese Nöte eben gibt. Wir brauchen auf jeden Fall den Blick auf die Utopie, wie es eigentlich sein sollte, sonst verliert man sich auf den Tausenden Baustellen.
Sie erwähnen die Rechte von Menschen mit Behinderung und das Recht auf gut begleitete Schwangerschaft, in dem Buch beschäftigen Sie sich aber nicht mit der auch unter Feministinnen hochumstrittenen pränatalen Diagnostik. Ableismus ist tief im System der pränatalen Diagnostik verankert; kann es überhaupt eine Schwangerenvorsorge geben, die nicht behindertenfeindlich ist?
Wir konzentrieren uns in dem Buch vor allem auf die Aspekte Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, Reproduktionstechnologien und Geburt, weil die direkt den Körper der schwangeren Person betreffen. Bei Abtreibungen nach pränataler Diagnostik gilt aber eigentlich das Gleiche, was ich vorhin zu Abbrüchen aus finanziellen Nöten gesagt habe: In einer behindertenfeindlichen Gesellschaft wird der Druck auf die Schwangeren, einen Abbruch zu machen, enorm hoch, wenn eine Behinderung festgestellt wird. Das Leben mit einem behinderten Kind ist deutlich schwieriger als mit einem Kind ohne Behinderung. Inklusion ist keine Realität, das wäre aber das Ziel, damit auch solche Fragen keine Rolle mehr spielen bei der Entscheidung für oder gegen eine Schwangerschaft.
Solange es aber noch anders ist, muss es für jede Schwangere individuell die Möglichkeit geben, die Schwangerschaft abzubrechen und die befürchtete Belastung nicht auf sich zu nehmen. Behindertenfeindlichkeit steckt tief im System. Das müsste sich extrem stark verändern, damit Menschen nicht mehr das Gefühl haben, ein Kind mit einer Behinderung wäre eine Last, die sie nicht bewältigen können. Und dann würden viele vielleicht auf solche Tests verzichten, weil die Information einfach nicht mehr wichtig wäre.

Dinah Riese ist Redakteurin der »Taz«. Für ihre Recherchen zum Paragraphen 219a hat sie mehrere Auszeichnungen erhalten. Zusammen mit Gesine Agena und Patricia Hecht hat sie in diesem Jahr das Buch »Selbstbestimmt. Für reproduktive Rechte« veröffentlicht.
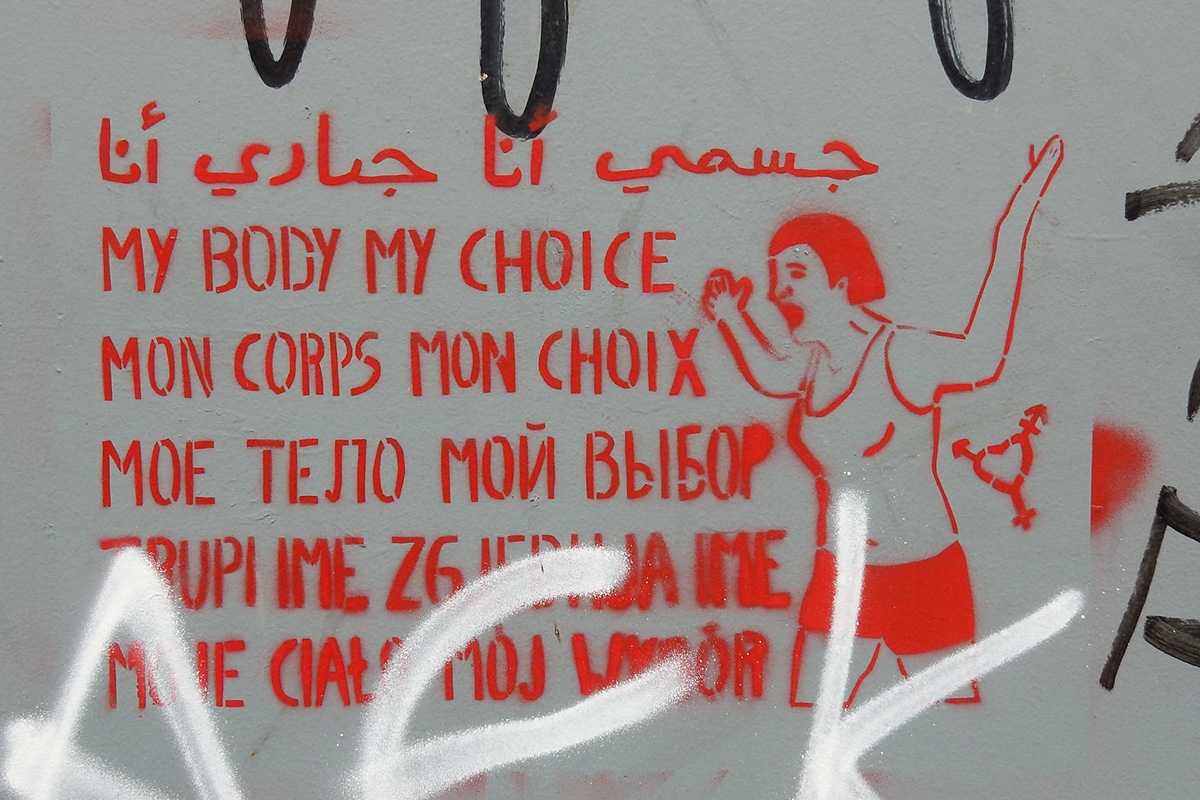


 »Tiktok bietet den großen Vorteil der Freiwilligkeit«
»Tiktok bietet den großen Vorteil der Freiwilligkeit«
