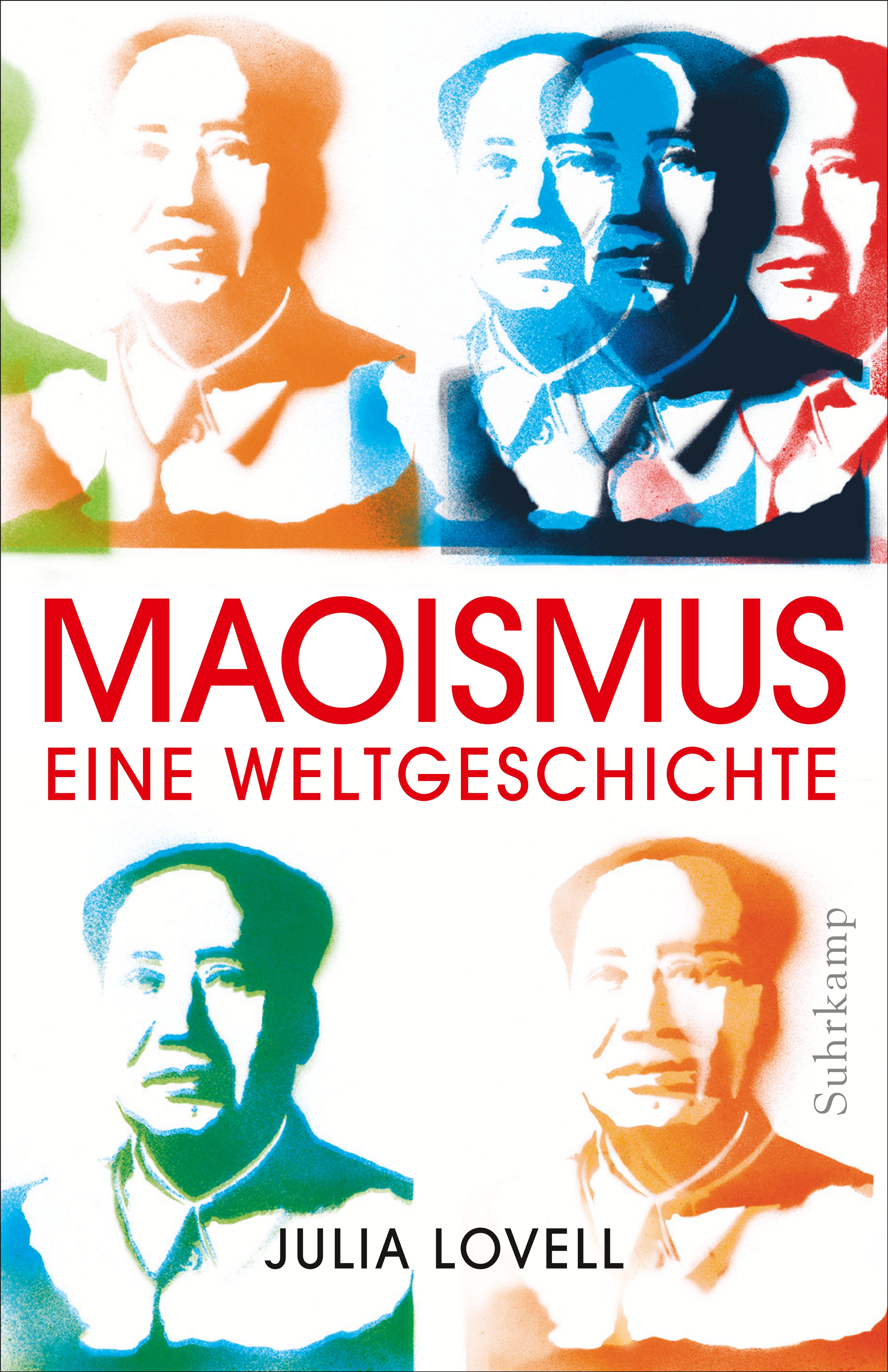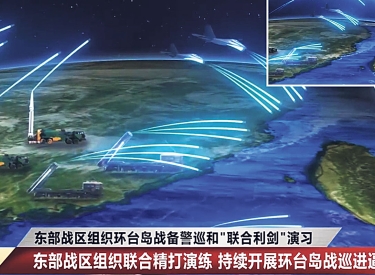Mao, der Manipulator
Es dürfte kaum etwas geben, das auf den ersten Blick so retro wirkt wie das Mao-Fieber der sechziger und siebziger Jahre, als es schon fast zum guten progressiven Ton gehörte, das eine oder andere griffige Zitat aus dem kleinen roten Buch in die Konversation zu werfen. Mit der sogenannten Mao-Bibel, einer Fibel mit 427 Aussprüchen des »großen Steuermanns« für jede revolutionäre Lebenslage, überschwemmte der Verlag für fremdsprachige Literatur in Peking ab 1964 die Welt, die bisherige Auflage wird auf eine Milliarde Exemplare geschätzt. Die Massenbegeisterung, ja Hysterie, die es entfachen half, wirkt wie ein zum wohligen Schaudern einladendes Relikt einer Epoche, die spätestens mit dem Machtantritt Deng Xiaopings 1978 reif, wenn nicht für den Müllhaufen, so doch für die Dachkammer der Geschichte schien.
Doch das täuscht, wie die britische Sinologin Julia Lovell in ihrer kürzlich auf Deutsch erschienenen Weltgeschichte des Maoismus zeigt. Der Mao-Kult feiert in China eine eigenartige Renaissance, erst recht seit Xi Jinping 2012 zum Generalsekretär der KP Chinas wurde. Eigenartig ist diese Renaissance, weil sowohl die Parteiführung als auch gegen sie Protestierende wieder gerne auf Mao rekurrieren. Legt die Partei Wert darauf, jenen Mao ins Gedächtnis zu rufen, der militärische Disziplin und absolute Hingabe des Einzelnen ans Kollektiv forderte, so hantiert sie doch mit einem zweischneidigen Schwert: Denn damit weckt sie eben auch Erinnerungen an den von Mao gepredigten Egalitarismus, daran, wie er die westliche Dekadenz geißelte und in der »großen proletarischen Kulturrevolution« zum Aufstand gegen eine »neue Ausbeuterklasse« in China aufrief – wiewohl es sich bei dieser Klasse im Kern lediglich um Maos Rivalen im Apparat handelte.
Das Mao-Fieber der sechziger und siebziger Jahre ergriff europäische Intellektuelle ebenso wie Stars der Populärkultur; doch es ergriff viel folgenschwerer nepalesische Teebauern, afrikanische Befreiungsbewegungen, peruanische Drogenguerilleros und indische Indigene.
Die Inlandspropaganda der KPCh des 21. Jahrhunderts versucht, dieses Problem umzugehen, indem sie eben diese Ära der Kulturrevolution von etwa 1965 bis 1978, dem Jahr, in dem der sogenannten Viererbande um Maos Witwe Jiang Qing der Prozess gemacht wurde, so totschweigt wie die KPdSU nach dem XX. Parteitag 1956 die Stalin-Zeit. Selbst die Archive Chinas halten Dokumente aus den Jahrzehnten der Kulturrevolution so hermetisch unter Verschluss, als ob es sich um ein geheimes Waffenprogramm handelte.
Doch es hilft nichts: Immer wieder protestieren Arbeitslose, indem sie, wie einst die Roten Garden, Mao-Bibeln schwenkend durch die Straßen ziehen. Immer wieder auch fordern die entrechteten Wanderarbeiter die Rückkehr zur »eisernen Reisschüssel«, die Mao in Reaktion auf die von ihm selbst provozierte Hungersnot des »Großen Sprungs nach vorn«, der forcierten Industrialisierung auf Kosten der Bauern, allen Chinesen garantiert hatte. Und die Landbevölkerung, deren Lebensstandard dem der legal in den Städten Lebenden so weit hinterherhinkt wie eh und je, erinnert sich immer wieder gern der Wertschätzung, die Maos Propaganda den bäuerlichen Massen entgegenbrachte (auch wenn er sie bei Bedarf verhungern ließ), und reinszeniert den einstigen »Volkskrieg« gegen Großgrundbesitzer, Dorfreiche und Städter, wenn sie mit Sicheln und Äxten gegen korrupte Beamte vorgeht.
Kein allein chinesisches Phänomen
Aber der Maoismus ist eben längst nicht nur ein chinesisches Phänomen, wie Lovell völlig zu Recht herausstellt: Das Mao-Fieber der sechziger und siebziger Jahre ergriff europäische Intellektuelle, allen voran Jean-Paul Sartre, ebenso wie Stars der Populärkultur wie Shirley MacLaine, Sergio Leone oder Paul Breitner; doch es ergriff viel folgenschwerer nepalesische Teebauern, afrikanische Befreiungsbewegungen, später peruanische Drogenguerilleros und – bis zum heutigen Tag – indische Indigene, die die dort Naxaliten genannten Maoisten auf nahezu einem Fünftel der Landesfläche zum andauernden Guerillakrieg organisieren.
Es sind Milieus, die miteinander nichts gemeinsam haben und sich doch gleichermaßen für die beiden Grundzüge des Denkens Maos begeisterten: Zum einen die umstandslose Überführung von gesellschaftlichen Widersprüchen in die rücksichtslose kriegerische Auseinandersetzung zwischen Gruppen – und damit die radikale Subjektivierung der jeweiligen auszumerzenden Volksfeinde und Volksfreunde; zum anderen die aus diesen Blutbädern folgen sollende brutale Vereinheitlichung des Volkswillens, die Verschmelzung des Denkens der Massen mit dem ihrer Führer, der »roten Sonne des Marxismus-Leninismus«, wie die Lobeshymnen Mao nannten, oder den »Vätern des Volkes«, wie sich die Herrscher der nordkoreanischen Kim-Dynastie noch heute betiteln lassen. »Der Maoismus scheint besonders für Verrückte geeignet, die sowohl entschlossen sind, mit der Gesellschaft in Konflikt zu treten, als auch sie zu beherrschen«, bemerkt Lovell trocken.
Der Maoismus war also eine Weltbewegung, die bis heute fortwirkt, selbst da, wo man es explizit nicht vermutet: Die Volkskriegskonzepte, die folkloristische Selbsterhöhung der geknechteten Völker, die Beschwörung der autochthonen Traditionen gegen die westliche Verderbnis – sie prägen »globale Radikalisierungsprozesse«, wie Lovell sich ausdrückt, die sich längst nicht mehr explizit auf den großen Vorsitzenden oder China beziehen. Der Maoismus, sein Revolutionsexport und seine weltweite Propaganda haben vielmehr geholfen, in der einst Dritte Welt genannten globalen Peripherie revolutionäre Bewegungen entstehen zu lassen, die auch noch die letzte Verbindungen zu den europäischen Emanzipationsbewegungen der Neuzeit und damit zur Aufklärung gekappt haben; Verbindungen, die den Maoisten selbst schon nicht mehr bedeuteten, als in Marx einen Vorfahren zu sehen, der im Land des Ahnenkults eben die Abstammungslinie des großen Vorsitzenden komplettiert. Dass die Mao-Zedong-Ideen in der islamischen Welt zu den Geburtshelfern des Jihad gehörten, wie die Autorin in ihrer umfassenden Schau maoistischer Agitation und ihrer jeweiligen Wirkung leider nur en passant schildern kann, erstaunt so nur auf den ersten Blick.
Maschinerie von Dumpfheit und Ärmlichkeit
In der Tat zeigt der Maoismus einen Übergang an, der der Globalisierung des späten 19. Jahrhunderts geschuldet ist, der Übergang des absoluten Elends von den pauperisierten Massen westlicher Industriezentren auf die expropriierten Massen Asiens und Afrikas. Unter dem stets fadenscheiniger werdenden Gewand des Marxismus entwickelte der Maoismus eine Denkweise, die den katastrophischen Prozessen entspricht, die die Eingliederung insbesondere der asiatischen Subsistenzwirtschaften in den Weltmarkt mit sich brachte: die Entstehung eines bald nach Milliarden zählenden ländlichen Halbproletariats, das zwar von seiner Subsistenz abgeschnitten war, aber nicht hoffen konnte, in klassischer Lohnarbeit eine Alternative dazu zu finden; eine desperate Surplus-Bevölkerung im Weltmaßstab.
Der »Große Sprung nach vorn« war für die Bauern zumeist der ins Grab – und doch hielt sich Mao an der Macht: Er profitierte von seinem Ruf als Nemesis der ewig Gedemütigten.
Mao war es, der entdeckte, wie man diese Bevölkerung in Bewegung setzen und sie dennoch beherrschen, ziellosen Aufruhr mit absoluter Tyrannei verbinden konnte; das, was er unter Klassenkampf verstand, war denn auch kein Mittel, um das Ende der Klassenherrschaft zu erreichen, sondern ein Existential ständiger Reinigung mit dem Endziel der Verschmelzung des Führers mit den Massen, denen jeder Individualismus, jede Abweichung ausgetrieben war, in einer riesigen Maschinerie von Dumpfheit und Ärmlichkeit.
Maos Versprechen, das durchaus verlockte, war, kurz gesagt: das, was man nicht erreichen konnte, zu zerstören; was, nebenbei gesagt, mit der Zivilisationsmüdigkeit bis -feindlichkeit, die die Zivilisation in ihrer kapitalen Form notwendig hervorbringt, bestens korrespondiert und wohl die Attraktivität dieser originären Ideologie für depravierte Massen bei der (sub)kulturellen Distinktion angeödeter Intellektueller und Künstler im Westen ausmachte.
Auf diesen Kontext des Maoismus als folgenreichem Ausfluss des globalen Verelendungsprozesses, der die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und damit erst recht das 20. Jahrhundert prägte, geht Lovell nicht weiter ein; vermutlich setzt sie einiges Wissen über die »Entstehung der Dritten Welt«, wie es Mike Davis nannte, bei ihrer englischsprachigen Leserschaft voraus, zumal sie ja selbst bereits einige Studien über die zentrale Rolle, die die Ausbeutung Chinas für das Empire spielte, vorgelegt hat: vor allem über die »Opium-Kriege« Großbritanniens gegen das Kaiserreich China Mitte des 19. Jahrhunderts.
Schreiender sozialer Kontrast
Für deutschsprachige Leser ist das allerdings ein Manko, das es erschwert zu verstehen, warum und inwiefern China geradezu prototypisch die idealen Bedingungen lieferte für Entstehung, Erfolg und weltweite Verbreitung des Maoismus. Denn im Kern des imperialen Welthandels ab Mitte des 19. Jahrhunderts stand die Dreiecksbeziehung zwischen Großbritannien, Indien und China. Indien diente als Riesenmarkt für immer weniger konkurrenzfähige britische Industrieprodukte und stabilisierte zugleich mit den Gewinnen aus agrarischen Exporten die Golddeckung des britischen Pfunds, dem es für eine Weile gelang, sich als Weltwährung von der schwächelnden britischen Industrie quasi abzukoppeln. In Wahrheit aber zahlte China in noch viel größerem Maßstab die Zeche dafür: Das Empire musste nichts investieren in das formal unabhängige Kaiserreich und konnte so ungeschmälert Gewinn extrahieren: Indische Baumwolle, indischer Tee und indisches Opium (eine Drogentransaktion, deren Ausmaß bis heute unübertroffen ist) überschwemmten den chinesischen Markt und zerstörten sowohl die subsistenzorientierte Landwirtschaft als auch die handwerkliche Produktion des Landes, das in riesige Elendszonen einerseits und verkehrsgünstig gelegene Handelszonen, vor allem an den Küsten, andererseits zerfiel.
Dieser soziale Kontrast hätte schreiender nicht sein können: In Shanghai erblühte die Filmindustrie, im Landesinneren verhungerten die Bauern; die chinesische Massenemigration jener Zeit kündete nahezu überall auf der Welt davon. Eine explosive Mischung entstand: eine kleine Arbeiterklasse, die nach 1917 unter bolschewistischem Einfluss stehen sollte, eine städtische Elendsboheme von Hasardeuren im Casino und in der Politik und riesige verzweifelte, desorientierte Massen. Deren Lage verschlimmerte sich noch, weil das Riesenreich, dessen Kaiser 1912 abdankte, in von Warlords beherrschte Gebiete zerfiel. Der Krieg aller gegen alle war Alltag und wurde von Japan, das im Nordosten Chinas imperiale Interessen verfolgte, nach Kräften geschürt.
Die junge Sowjetunion trat als Gegenspieler auf, rüstete die Truppen der chinesischen Nationalbewegung auf, in der die eher auf die städtische Bourgeoisie gestützte konservative Kuomintang die regulären Truppen führte, die wiederum mit der erstarkenden KP Chinas in den großen Städten und deren Umgebung gegen die Warlords zusammenarbeiteten; sobald Chiang Kai-shek, der Anführer der Kuomintang, sich mächtig genug fühlte, trachtete er, sich der KP zu entledigen. Dem von den Kuomintang angerichteten Massaker im »roten« Shanghai 1927 folgten landesweit weitere von kaum vorstellbarer Grausamkeit, Schätzungen zufolge ging die Zahl der des Kommunismus verdächtigen Opfer in die Millionen.
Zügelloser Aufstand, äußerste Tyrannei
Mit dieser Katastrophe einher ging der Aufstieg des jungen Mao, der eine regelrechte Obsession für das Militärische und die Gewalt entwickelte: Sie war Mao und seiner wachsenden Schar von Getreuen der Zustand, aus dem sich die revolutionäre Moral herausbildet und die bürgerliche Dekadenz und Trägheit ausgemerzt wird, denn der Feind lauerte überall, nicht nur auf der Gegenseite; alles, was, und alle, die der revolutionären Moral und damit der vollständigen Militarisierung der Gesellschaft entgegenstanden, mussten im andauernden Volkskrieg – also in einer Art permanentem organisiertem Bürgerkrieg – ausgemerzt werden. Dieser Volkskrieg war von Anfang an durchaus global gedacht, mit China als Zentrum eines weltweiten revolutionären Fegefeuers. »Ein revolutionärer Krieg ist ein Gegengift, das nicht nur das Gift des Feindes vernichtet, sondern auch unsere eigenen Schlacken hinwegsäubert«, schrieb Mao 1938.
Die Landreformen, die bäuerliche Subsistenz wieder ermöglicht hatten und denen die KP ihre ländliche Basis und damit den Sieg im Bürgerkrieg 1949 verdankte, kassierte die Partei alsbald ein. Sie verfolgte nunmehr eine Industrialisierungsstrategie, die das Stalin’sche Vorbild eher noch übertraf, was die Millionenzahl der Hungertoten anbelangt. Der »Große Sprung nach vorn« (ab 1958) war für die Bauern zumeist der ins Grab – und doch hielt sich Mao an der Macht: Er profitierte von seinem Ruf als Nemesis der ewig Gedemütigten. Weil Mao die ohnehin grausame Rache, die die Bauern an Grundbesitzern verübten, über Jahrzehnte gefördert und intensiviert hatte, war man auf dem Land stetige Terrorkampagnen gewohnt; erst durch die revolutionäre »Kraftentfaltung der Bauern kann man die Millionenmassen in Bewegung setzen, damit sie zu einer gigantischen Kraft werden«, hatte Mao 1927 programmatisch formuliert.

(Bild: picture alliance / akg-images)
Und so führte er auch die Partei: Geschickt wusste er schon in den ersten »Berichtigungskampagnen« nach dem verheerenden »Langen Marsch« (1934/1935) die Wut aufs Privileg zu kanalisieren. Bonzen und Unbotmäßige wurden in einem Aufwasch gleichermaßen erledigt: Erstere exemplarisch, Letztere prinzipiell. Maos Methode, zügellosen Aufstand mit äußerster Tyrannei zu verknüpfen, bestand nicht zuletzt darin, das, was in der Sowjetunion noch zu Recht als von oben vorgegebene »Parteilinie« galt, in »Massenlinie« umzutaufen, in der die Partei, das heißt deren Führung, nur wie ein Katalysator der Volksstimmung erscheint, und damit verbreitete Unzufriedenheit am ausgesuchten Objekt sich austoben zu lassen. Davon kündet Maos berühmte »Theorie des Widerspruchs« als dem »stetigen Kampf der Gegensätze«.
Mao kanalisierte die Unzufriedenheit mit dem üblichen Furor, als Aufstand der Massen gegen die »neue Ausbeuterklasse« in Form einer »Revolution, die die Seelen erfasst«.
Dieses Muster wiederholte Mao auch in der sogenannten Kulturrevolution. Er kanalisierte die Unzufriedenheit neuerlich zu seinen Gunsten und mit dem, man muss schon sagen, üblichen Furor, als Aufstand der Massen gegen die »neue Ausbeuterklasse« in Form einer »Revolution, die die Seelen erfasst«. Was sie aus den Seelen der zum Aufstand Animierten hervorkehrte, ähnelte dem, was sich schon in den Kampagnen zum »Klassenkampf auf dem Lande« oder im Bürgerkrieg gezeigt hatte: Wütende Massen degradierten, demütigten, folterten und massakrierten die, die man ihnen zum Abschuss freigab. Wo ernsthafte soziale Forderungen (Arbeiterkontrolle, Lohnerhöhungen, Entwicklung auf dem Land) gestellt wurden, intervenierte hingegen die Armee.
In China sistierte die Partei die Kampagne nach Maos Tod 1976 schließlich, anderswo wirkte sie weiter – doch das Ergebnis blieb stets dasselbe: Das von China exorbitant geförderte sozialistische Experiment in Nyereres Tansania endete in einer Hungersnot, ebenso die Landreform in Mugabes Zimbabwe, die jeweiligen im Ursprung maoistisch orientierten Einheitsparteien sind dort jedoch bis heute an der Macht.
Die Indienstnahme der ungezügelten, von objektiven Umständen auf Feindsubjekte umgeleitete Wut durch eine voluntaristische Avantgarde zu diesem oder jenen blutrünstigen gesellschaftlichen Großexperiment, wie dem Maos oder dem des vom greisen Parteichef zum Nachfolger im Geiste geadelten Pol Pot, mag nicht mehr zeitgemäß erscheinen – Maos Herrschaftstechnik, Aufstand und Tyrannei in einem Prozess steter Mobilmachung zu kombinieren, aber hat Bestand, sprich: viel zu viele Nachahmer.
Julia Lovell: Maoismus. Eine Weltgeschichte. Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm und Norbert Juraschitz. Suhrkamp, Berlin 2023, 768 Seiten, 42 Euro