Befreite Bedürfnisse
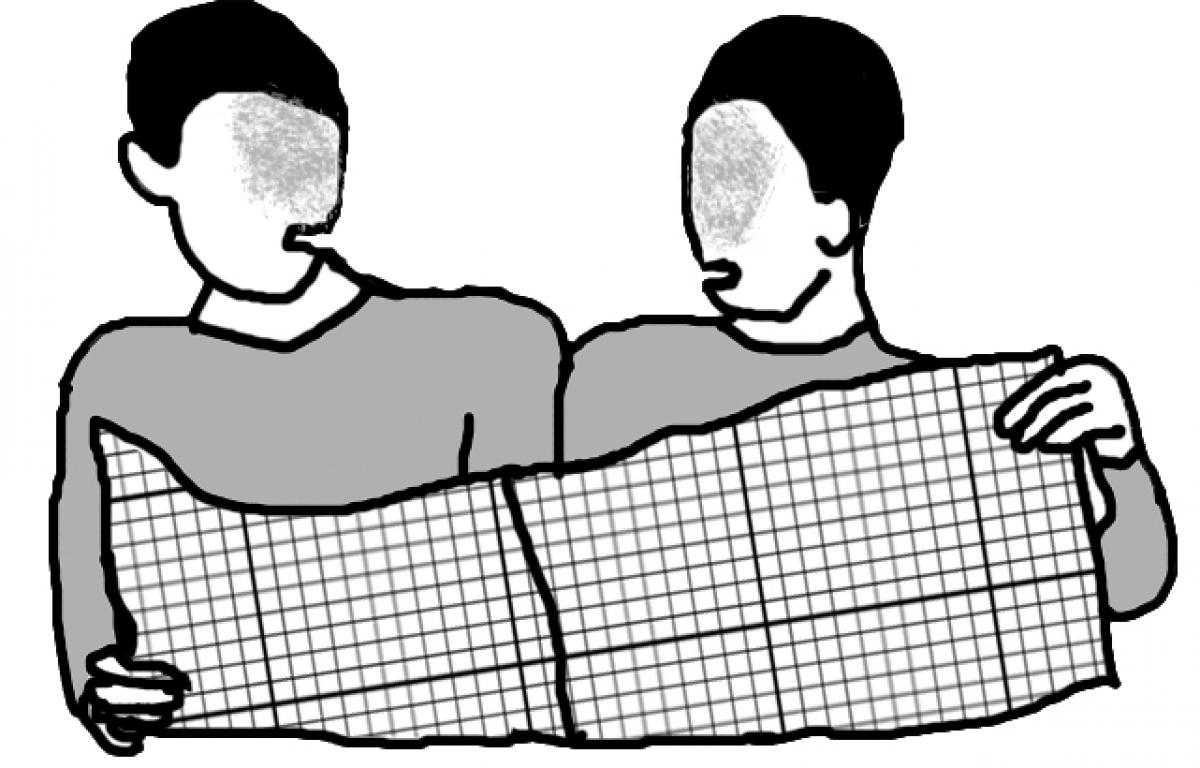
Vor einem Jahr veröffentlichten Robin Celikates, Rahel Jaeggi, Daniel Loick und Christian Schmidt »11 Thesen zu Bedürfnissen« auf der Website »Kritische Theorie in Berlin«. In seiner Kritik an diesem Text argumentierte Julian Kuppe, dass die Vermittlung von Bedürfnisbefriedigung durch das Kapitalverhältnis zum Gegenstand der Kritik gemacht werden müsse (»Jungle World« 17/2024). Thomas Land verwarf hingegen generell Gesellschaftskritik, die die Bedürfnisse zu ihren Ausgangspunkt nimmt, und forderte eine Kritik der Ausbeutung (19/2024).
*
In der Dystopie, die Aldous Huxley in seinem Roman »Brave New World« entwirft und an der sich die Diskussion der Kritischen Theoretiker über Bedürfnisse 1942 entzündete, gibt es keine Not mehr, denn alle Bedürfnisse werden – im Zweifel durch den Konsum der Droge Soma – erfüllt. Doch während Huxley der Gesellschaft der befriedigten Bedürfnisse in der Figur des John Savage die Schriften Shakespeares entgegenhält, um die Banalität eben jener Bedürfnisbefriedigung zu geißeln, hält es Thomas Land mit Ökonomiekritik.
Selbst wenn es gelänge, die »materiellen Bedürfnisse der Menschheit zu erfüllen«, argumentiert er, sei die kapitalistische Produktionsweise noch zu kritisieren, und zwar anhand der Ausbeutung, die sich an der Mehrwertrate bemesse. Der so vom Bedürfnis entkoppelte ökonomistische Ausbeutungsbegriff Lands hat nun aber ebenso seine kritische Spitze verloren wie zuvor der intersektional verwaltete Bedürfnisbegriff, der in den kritisierten »11 Thesen zu Bedürfnissen« vom KTB verwendet wird, oder der rebellisch naturalisierte von Julian Kuppe.
Die ungarische Philosophin Ágnes Heller schrieb 1976 in ihrer »Theorie der Bedürfnisse bei Marx«, dass der Begriff der Bedürfnisse keineswegs auf eine ökonomische Kategorie zu reduzieren sei, sondern die »geheime Hauptrolle« in der Marx’schen Kritik einnehme. Die Innovationen der Marx’schen Kritik, wie die begriffliche Trennung von Arbeit und Arbeitskraft, die Dechiffrierung des Ursprungs des Mehrwerts und zuletzt die analytische Erfassung des Gebrauchswerts, bauen, so Heller, auf dem Begriff des Bedürfnisses auf. Dass die Ware mit ihrem Gebrauchswert Bedürfnisse befriedigen muss, gilt auch beim Verkauf der Ware Arbeitskraft. Sie folgt dem Verwertungsbedürfnis des Kapitals.
»Ausbeutung heißt vor allem, dass die Arbeiter um die geschichtsbildende Kraft ihrer als Mehrarbeit gesetzten lebendigen Arbeit betrogen werden.« Wolfgang Pohrt
Wie Land richtig anführt, reproduziert sich das Kapital über die Produktion von Mehrwert, das heißt darüber, dass die Arbeitskraft zum Gebrauchswert des Kapitals wird, der Arbeiter sie jedoch zu ihrem Tauschwert verkauft. Dieser Tauschwert bemisst sich an dem, was dem Arbeiter zu seiner Reproduktion zugestanden wird. Dies ist historisch wie gesellschaftlich kontingent und auch Resultat gesellschaftlicher Kämpfe. Die Bedürfnisse unterm Kapital sind aber kaum statisch. Dadurch, dass sich das Kapital mittels Ausbeutung der Arbeitskraft auf immer höherer Stufenleiter reproduziert, schafft es erst die Bedingungen, um die Arbeit über die Grenzen der Naturnotwendigkeit hinauszutreiben, und so überhaupt erst die Möglichkeitsbedingung für die Emanzipation des Menschen.
Der springende Punkt der Marx’schen Kritik ist damit, dass sie nicht eine ökonomistische Theorie der Ausbeutung ist oder die Forderung nach gerechtem Lohn aufstellt, sondern auf die Aneignung der erst vom Kapital selbst gesetzten Möglichkeiten zielt, die dem Menschen unter diesem nur in ihrer entfremdeten Form zugänglich sind. Nicht, dass der Arbeiter um seinen vermeintlich gerechten Anteil am Reichtum betrogen würde, ist der Skandal bei Marx, sondern die entfremdete Form des Reichtums selbst, der als abstrakter Reichtum gezwungen ist, als Warensammlung zu erscheinen, und dadurch den Arbeiter von seinen so erst sich entwickelnden geschichtlichen Möglichkeiten trennt, die es revolutionär anzueignen gälte.
Der Reichtum wird um seine gesellschaftliche Verwirklichung gebracht
Der Skandal kapitaler Produktion ist folglich auch nicht, von der Befriedigung der Bedürfnisse durch die Warenförmigkeit der Gebrauchsdinge abgeschnitten zu sein. Vielmehr ist es so, dass das Kapital erst bestimmte Bedürfnisse in den Menschen weckt und entwickelt, die aus dem unmittelbaren Zusammenhang mit der Natur befreien. Der abstrakte – und damit noch in verkehrter Form sich entwickelnde – Reichtum wird damit zur Grundlage der Befreiung, und die Warenförmigkeit kann ungeahnte Bedürfnisse hervorbringen.
In dieser verbleibend, wird jedoch der Reichtum um seine gesellschaftliche Verwirklichung gebracht. Die Maßlosigkeit der kapitalistischen Akkumulation, die sich einem Naturprozess gleich über die Menschen hinweg vollzieht, steht im Widerspruch zu Marx’ Vorstellung von der »disposable time« als wahrem Reichtum, die erst aus dem revolutionär aufgehobenen abstrakten Reichtum entspringen kann.
Entsprechend ist, worauf Wolfgang Pohrt hinwies, auch der Ausbeutungsbegriff von allen sozialfürsorgerischen Flausen zu befreien:
»Ausbeutung heißt vor allem, daß die Arbeiter um die Geschichte, die sie machen, betrogen werden, um die geschichtsbildende Kraft ihrer als Mehrarbeit gesetzten lebendigen Arbeit, die erstmals wirklich die gegenständliche Welt als Bedingung der subjektiven Tätigkeit des Menschen setzt, sie real zur Domäne seines Willens macht; ob die Arbeiter dabei satt zu essen haben, ist wichtig, aber es ändert nichts am Prinzip.«
Einheit von Gesellschaftskritik und Revolutionstheorie
Marx konnte diese Kritik im Gegensatz zur auf ihn folgenden Kritischen Theorie noch unter der Annahme einer gesellschaftlichen Klasse formulieren, die jenes radikale Bedürfnis, die Entfremdung aufzuheben, verkörpere. Erst durch die mögliche Verwirklichung des radikalen Bedürfnisses, nach Marx die »Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Productivkräfte etc der Individuen«, erhalten die Begriffe Bedürfnis und Ausbeutung ihre kritische Bedeutung.
Ohne das radikale Bedürfnis ist die Marx’sche Kritik nicht der theoretische Ausdruck der realen Bewegung, sondern wird, wie es Karl Korsch einmal formulierte, zu bloßer Literatur. Entsprechend musste die Einheit von Gesellschaftskritik und Revolutionstheorie nach Marx mit dem Ausbleiben der Revolution auch zerbrechen.
Die entfremdeten Verhältnisse schufen nicht, wie Marx annehmen konnte, das Bedürfnis nach Befreiung, sondern das nach sozialstaatlicher Integration oder nach dem Volksstaat und artikulierten sich nicht zuletzt im antisemitischen Wahn.
Die entfremdeten Verhältnisse schufen nicht, wie Marx annehmen konnte, das Bedürfnis nach Befreiung, sondern das nach sozialstaatlicher Integration oder nach dem Volksstaat und artikulierten sich nicht zuletzt im antisemitischen Wahn. Doch nicht nur, dass der Verwirklichung der Vernunft kein sich durchsetzendes Bedürfnis entgegenkommt, berührt die Kapitalkritik, sondern auch, dass sich das Kapital gegen seine revolutionäre Aufhebung durch verschiedene Formen der regressiven Krisenlösung abgedichtet hat, was insbesondere in der Kritischen Theorie reflektiert wurde.
Der Versuch Herbert Marcuses, den Zwang zu rebellieren in einem biologischen Substrat zu verorten, oder Adornos Festhalten an einem somatischen Impuls, am Hinzutretenden, können Auskunft darüber gegeben, auf welch verlorenem Posten sich die Hoffnung auf eine vernünftige Einrichtung der Verhältnisse befindet. Weder ist dem Bedürfnis der Menschen zu glauben, noch kann man ob der gesellschaftlichen Form der Bedürfnisse zwischen einer Überformung und einem Natursubstrat trennen.
Es gibt keinen vorkapitalistischen, sprich: vormodernen Rest, wie er in Kuppes rebellisch naturalisierten Bedürfnisbegriff aufscheint, der gegen die Kolonisierung des Kapitals zu retten wäre, noch gibt es einen festen Standpunkt letztlich geschichtsloser Ökonomietheorie, wie ihn Land einnimmt, der vom Schwinden ihres ursprünglichen Adressaten, dem Träger des radikalen Bedürfnisses, nicht bereits untergraben und so jeglichen Kritikmaßstabes verlustig gegangen wäre. Festzuhalten ist vielleicht nur, dass jede Orientierung an den Begriffen von Bedürfnis oder Ausbeutung ohne Erinnerung an den realen historischen Verlust ihres revolutionären Gehalts sinnlos ist.






