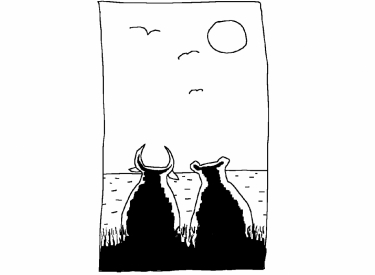Einzelteile abschaffen
»Abolition setzt voraus, dass wir eine Sache ändern: nämlich alles.« Mit diesem Slogan, den die US-amerikanische Abolitionistin Ruth Wilson Gilmore geprägt hat, wirbt die für den 23. und 24. Juni in Hamburg geplante »Internationale Bewegungskonferenz: Racial Capitalism – Krisen – Abolition«. Leider hat der Abolitionismus, wie er dieser Tage in Deutschland von Wissenschaftlern wie Vanessa E. Thompson oder Daniel Loick verbreitet wird, außer markigen Sprüchen wenig mehr zu bieten als die üblichen Antirepressionskampagnen der Bewegungslinken.
Das selbstgesteckte Ziel, alles zu verändern, würde einen Begriff von gesellschaftlicher Totalität voraussetzen, mit dem Gesellschaft als ein Gesamtzusammenhang ausdifferenzierter und spezialisierter Teilsysteme verstanden werden kann. Den Abolitionisten fehlt jedoch die Kategorie eines funktionalen Ganzen, wie sie Marx als Produktionsverhältnis beziehungsweise Gesellschaftsformation verstand. Entsprechend kritisieren sie die Polizei nicht ausgehend von ihrer Funktionen im bürgerlichen Rechts- und Verfassungsstaat, sondern vielmehr durch den – empirisch kaum belegten – Nachweis ihrer kolonialen Kontinuität.
Worin sich die Einheit all dieser Konflikte, Kämpfe und Proteste begründet, bleibt im Dunkeln.
Das additive Verständnis des Ganzen als einer Kombination verschiedener Unterdrückungs-, Ausbeutungs- und Ausgrenzungspraktiken korrespondiert mit einem politischen Aktivismus, der diverse Formen von »struktureller Gewalt« durch die »Vernetzung« der unterschiedlichen »Formen des Widerstandes« überwinden will. So heißt es im Ankündigungstext der Konferenz: »Die Rebellionen für schwarze Leben, antikoloniale Kämpfe, feministische Bewegungen, wilde Streiks, die Organisation von Geflüchteten und Migrant:innen, die Gewerkschaften von Gefangenen, Anti-Repressions-Gruppen, Mutual-Aid-Kollektive, Kämpfe gegen die Ausbeutung und Unterdrückung, Initiativen für Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen sowie die planetare Klimabewegung stellen sich staatlichen Gewaltformen entgegen.«
Worin sich allerdings die Einheit all dieser Konflikte, Kämpfe und Proteste begründet, bleibt im Dunkeln. Denn wichtiger als die begriffliche Synthese der weitgehend isoliert betrachteten Phänomene zu einer gedanklichen Totalität sind dem Politaktivismus die »konkreten Praktiken im Hier und Jetzt«, so die Ankündigung weiter.
Weil die einzelnen Organisationen des kapitalistischen Staats nicht als Elemente einer Einheit, also als Bestandteile eines gemeinsamen Strukturzusammenhangs, erfasst werden, reduziert sich Kritik des Staats im Abolitionismus auf die – zumeist moralisch begründete – Ablehnung dieser oder jener spezifischen Institution wie Polizei, Gefängnis, Staatsgrenze oder Flüchtlingslager.
Im Abolitionismus bleibt die Form des kapitalistischen Staats unbestimmt, aus der die für eine kapitalistische Vergesellschaftung unentbehrlichen staatlichen Funktionen erst abzuleiten wären.
Das dahinterliegende Prinzip des staatlichen Gewaltmonopols und seine Notwendigkeit in einer Gesellschaft gegensätzlicher Interessen wird dabei nicht erfasst. Eine auf Privateigentum basierende Produktionsform bedarf einer von ihr getrennten, übergeordneten politischen Herrschaft. Sie übernimmt all jene Regulierungs- und Reproduktionsaufgaben, auf die das Kapital angewiesen ist, ohne sie jedoch selbst zu erfüllen – wozu auch Polizei und Justiz gehören. Die Notwendigkeit, allgemeine Produktionsbedingungen des Kapitals durch den Staat herzustellen, bedingt, dass man nicht einfach diese oder jene Momente der (Re-)Produktionsbedingungen (wie Polizei, Recht oder Staatsgrenze) durch etwas anderes ersetzen kann, das aus humanitärer Sicht vielleicht wünschenswert wäre.
Im Abolitionismus bleibt die Form des kapitalistischen Staats unbestimmt, aus der die für eine kapitalistische Vergesellschaftung unentbehrlichen staatlichen Funktionen erst abzuleiten wären. Stattdessen wird das – mit Marx gesprochen – organisch Zusammengehörende lediglich zufällig aufeinander bezogen. So gelangen die Abolitionisten zu der absurden Forderung, Organisationen abzuschaffen, auf die der kapitalistische Normalbetrieb notwendig angewiesen ist.
Und weil sie die Unmöglichkeit dieser Forderung zumindest zu ahnen scheinen, schlagen sie – so pragmatisch wie reformistisch – für jede abgeschaffte Institution auch gleich ein funktionelles Äquivalent vor, das dieselben Leistungen »von unten«, also durch die »Community« erbringt. Damit werden sie unfreiwillig zu Trägern einer Modernisierung, die ohnehin im Interesse eines »aktivierenden« kapitalistischen Staats liegt: In Zukunft nehmen die Beherrschten zum Beispiel die Justiz- und Gefängnisreform gleich selbst in die Hand, wenn sie selbstorganisiert, freiwillig und unentgeltlich sozialintegrative Maßnahmen anstelle teurer Gefängnisaufenthalte anbieten.