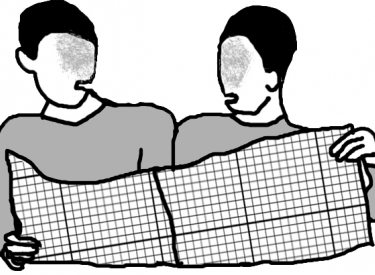Freiheit, Arbeit, Rauchen
Die Freiheit, nicht zu rauchen
Sich im Nachtleben und an geselligen Orten am Rauchen der Mitmenschen zu stören, gilt als spießig und pedantisch. Dass dem uneingeschränkten Rauchen das Image von Freiheit anhängt, ist auch ein Verdienst der Tabaklobby.
Von Anastasia Tikhomirova
Zusammen mit Freund:innen sitze ich in einer Restaurant-Bar. Eine:r nach der:dem anderen fängt, noch während wir essen, an zu rauchen. Es wird weder gefragt, ob es für alle am Tisch in Ordnung sei, noch auf Husten und die den Rauch wegfächernde Handbewegung reagiert. Schließlich wird angenommen, dass ohnehin beinahe alle rauchen. Die Nichtraucher:innen und auch diejenigen, die mit dem Rauchen aufhören wollen: Kollateralschäden. Die Hürde, zu sagen, dass man sich an dem Rauch stört, und so zu riskieren, als Spießerin oder Spaßverderberin dazustehen, ist hoch.
Später am Abend suchen wir einen Berliner Technoclub auf. Auch hier wird überall gequalmt, selbst auf der Tanzfläche ist man nicht vor umhergeschwenkten Zigaretten sicher. Die Ausgehkleider haben bereits Brandlöcher und mein Arm zwei Brandmale von vergangenen Tanzveranstaltungen, deshalb suche ich das Weite, sobald ich rauchenden Ravende in meiner Nähe erblicke. Zu Hause angekommen kratzt es im Hals. Die Klamotten stinken dermaßen nach Rauch, dass eine Extraladung Waschmittel in die Waschmaschine gekippt wird.
Das Beschriebene mag für viele nach Spießertum klingen. Dabei ist es seit den siebziger Jahren wissenschaftlicher Konsens, dass Passivrauchen nicht nur eine Belästigung, sondern eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit mit Todesfolge darstellt. Das Deutsche Krebsforschungszentrum stellte 2005 klar, dass 70 Substanzen des Tabakrauchs krebserregend sind. Tabak gilt nicht umsonst als eine der tödlichsten Drogen.
Es ist seit den siebziger Jahren wissenschaftlicher Konsens, dass Passivrauchen nicht nur eine Belästigung, sondern eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit mit Todesfolge darstellt.
Die Tabakindustrie sah in diesen Befunden eine Bedrohung ihrer Profite, weshalb sie versuchte, Zweifel daran zu säen. In der Lobbyarbeit gegen Rauchverbote oder Regulierungen behauptete sie stets, für »Freiheit« und »Toleranz« zu argumentierten. Bis heute übernehmen auch sich progressiv wähnende Menschen diese Propaganda, wann immer jemand auf ein Rauchverbot drängt.
Insbesondere in Berlin scheint das zu fruchten: Das seit 2008 geltende Rauchverbot in Innenräumen wird insbesondere in Clubs missachtet. Clubbetreibende ignorieren die Ausschlüsse, die sie dadurch erzeugen: Asthmapatient:innen, Schwangere, Menschen mit Sucht- oder Krankheitsgeschichte oder jene, die einfach keine Lust auf Passivrauchen haben, werden so aus dem kulturellen Leben verdrängt. Eine Ausgehkultur, die immer mehr Wert auf Awareness- und Antidiskriminierungskonzepte legt, versagt in diesem Fall darin, die körperliche Selbstbestimmung, Arbeitsschutz und Barrierefreiheit zu garantieren.
Dabei geht es nicht darum, Rauchen generell zu verbieten. Jedoch muss die Entscheidung, sich vermeidbaren Gesundheitsrisiken auszusetzen, immer freiwillig sein. 2014 befürworteten 75 Prozent der deutschen Bevölkerung rauchfreie Clubs. Sogar 57 Prozent der Raucher:innen stimmten der Idee zu, denn auch sie werden durch ein Rauchverbot in Innenräumen vor einer Mehrfachbelastung geschützt. Anstatt diese Forderung nach Rücksichtnahme zu belächeln, muss sie Eingang in Antidiskriminierungsdebatten finden, wie an den meisten anderen Ausgehorten in Europa auch – und das nicht nur am Weltnichtrauchertag.
***
Rauchen statt arbeiten
Wer im Kampf gegen das Rauchen nach dem starken Staat ruft, verpasst die Chance, sich mit seinen Mitmenschen in Beziehung zu setzen. Statt mit dem Rauchen lasterhafte Freuden anderer regulieren zu wollen, sollte man besser die schädlichen Folgen der Arbeit für die Gesundheit thematisieren.
Von Pascal Beck
Eine Packung Zigaretten soll künftig 23 Euro kosten – zumindest wenn es nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht. Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO, bezifferte die Kosten, die Rauchen in Deutschland verursacht, auf 97 Milliarden Euro pro Jahr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts nimmt der Staat nur rund 15 Milliarden Euro mit der Tabaksteuer ein. Der erwähnte Preis ergibt sich aus der Steuererhöhung, die nötig wäre, damit die Einnahmen die anfallenden Kosten durch rauchbedingte Krankheiten und Arbeitsausfälle decken.
Auch der drogenpolitische Sprecher der Linkspartei, Ates Gürpinar, sprach sich in der Berliner Zeitung für »eine deutliche Erhöhung der Steuern auf Rauchtabakprodukte« aus. Damit wolle er Raucher nicht bestrafen, sondern ihnen lediglich dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wer nicht hören will, muss demnach für die Folgen seines Lebenswandels selbst aufkommen. Wer raucht, hat, so die Überlegung hinter diesen Forderungen, kein Anrecht auf finanzielle Unterstützung durch Nichtraucher und sollte deshalb noch tiefer in die Tasche greifen müssen.
Die WHO fordert indes nicht nur Steuererhöhungen, sondern auch eine Ausweitung des Rauchverbots in Deutschland. An öffentlichen Orten wie Bahnhöfen sollte demnach ein striktes Rauchverbot gelten. Die Regeln in Deutschland blieben hinter denen in anderen europäischen Ländern zurück. 2019 verbot Schweden das Rauchen in Außenbereichen vor Restaurants, Kneipen, Cafés und Einkaufzentren sowie auf Bahnsteigen und an Bushaltestellen. Paris verdrängte die Zigarette im selben Jahr aus zahlreichen Parks. Der Tenor dabei ist meist der Gleiche: Ein Verbot sorge nicht für Unfreiheit, sondern für mehr Freiheit – jener der Nichtraucher, sich nicht dem schädlichen Qualm aussetzen zu müssen.
Jede Form des glücklichen Lebens mit spontaner Aggression abzulehnen, ist ein Ausdruck des tyrannischen Über-Ich, das dem andern die Freuden nicht gönnt, denen man selbst entsagt.
Dabei wird eine entscheidende Sache unterschlagen: Der öffentliche Raum ist eben nicht privat. Nervige Angewohnheiten anderer kommen inklusive. Statt sich jedoch zueinander in Beziehung zu setzen, für sich selbst zu handeln und beispielsweise Abstand zu halten, ruft man lieber nach einem starken Staat, der mittels Verboten die eigenen Interessen durchsetzen soll. Die verschiedenen Akteure im öffentlichen Raum wird eine solche Vorgehensweise sicher nicht zusammenbringen, um einen Konsens zu finden, sondern sie im schlimmsten Fall noch weiter voneinander isolieren.
Der Kulturphilosoph Robert Pfaller beklagt ein gestörtes Verhältnis zum Genuss, ein tyrannisches Über-Ich, das uns dazu bringe, uns nichts zu gönnen und uns ständig vor allem zu fürchten. Statt vor dem Tod sollten wir uns seiner Ansicht nach lieber vorm schlechten Leben fürchten. Heutzutage würden die Menschen Zwänge internalisieren und eben das, wozu man gezwungen wird, auch noch zur Utopie erheben. Wenn wir uns zu rigoros einschränken, verwehrten wir uns die wenigen Freuden und Triumphe, die wir im Leben haben. Jede andere Form des glücklichen Lebens mit spontaner Aggression abzulehnen, sei letztlich nur ein Ausdruck des tyrannischen Über-Ich, das dem andern die Freuden nicht gönnt, denen man selbst entsagt.
Der sogenannte Stresstest der Techniker Krankenkasse belegte: Arbeit macht krank, ist Mühsal, macht hässlich. Die Studie zeigt, dass die Arbeitsbelastung in Deutschland gestiegen ist und Dauerstress sowie psychischer Druck für viele Menschen zum Arbeitsalltag gehören; verbunden mit gesundheitlichen Folgen. Mehr als 80 Prozent der Befragten beklagten Rückenschmerzen und Erschöpfung, mehr als die Hälfte leidet unter Nervosität und Schlafstörungen. Auch die Krankenkassen schlagen Alarm. In Anbetracht dieser Studie sollte das Recht der Einzelnen auf kleine, sinnlose Lustbarkeiten gegen das Nützlichkeitskalkül der Krankenkassen verteidigt und stattdessen lieber die Arbeit niedergelegt werden. Rauchen ist ein geselliger und sozialer Akt, Lohnarbeit hingegen gewiss nicht.