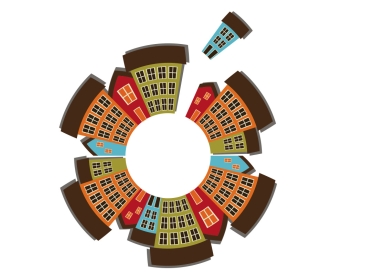»Der Markt konnte die Wohnungsfrage nicht lösen«
Warum ist das Thema öffentlicher Wohnungsbau heutzutage wieder relevant?
Dass es eine Wohnungskrise gibt, ist mittlerweile allgemein anerkannt. Aber mit der herrschenden Neubaupolitik entstehen nur wenige bezahlbare gute Wohnungen. Trotz des hohen Bedarfs wird nur ein geringer Teil des Neubaus als sozialer Wohnungsbau staatlich gefördert. Außerdem zeigt die derzeitige Situation, in der aufgrund der gestiegenen Baukosten insgesamt immer weniger Wohnungen, aber insbesondere weniger Sozialwohnungen gebaut werden, dass der soziale Wohnungsbau überhaupt nur funktioniert, wenn der Staat den Wohnungsbauunternehmen die immer größer werdende Kluft zwischen den Mieten, die nötig sind, damit sich die Investitionen in den Bau rentieren, und den gewünschten Sozialmieten permanent durch Zuschüsse füllt. Alle großen Verbände der Wohnungswirtschaft fordern derzeit mehr Wohnbauförderung, weil selbst die Mittelschicht die derzeitigen Neubaumieten oft nicht mehr bezahlen kann. Wohnbauförderung ist natürlich richtig, aber wichtig ist ebenfalls, darüber zu reden, welchen Zweck diese Förderung eigentlich hat und wer an ihr wie viel verdienen soll.
Wie sieht die gängige Praxis in Deutschland aus?
Das deutsche Modell, bei dem mit staatlicher Förderung gebaute Wohnungen nur für meist 20 oder 30 Jahre als Sozialwohnungen vermietet werden müssen, ist nicht nachhaltig. Wenn die Sozialbindung ausläuft, werden sie von ihren Eigentümern zu Marktpreisen vermietet. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland 2022 sogar um 27.000 zurückgegangen ist. Das ist ein seltsamer deutscher Sonderweg, der hierzulande aber immer noch unbeirrt verfolgt wird.
Was müsste sich ändern?
Die beste Option wären ein gemeinnütziger Wohnungsbausektor und ein starker kommunaler Wohnungsbau, die nicht der Renditemaximierung verpflichtet sind. Die Bundesregierung hat versprochen, ein entsprechendes Förderprogramm für gemeinnützigen Wohnungsbau zu schaffen. Auch wenn das wohl kein großer Wurf werden wird, zeugt das wenigstens von Problembewusstsein.
Wie würden Sie den Zustand des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland beschreiben?
Sozialer Wohnungsbau ist in Deutschland nur noch ein schrumpfender Sonderwohnsektor für die Ärmsten und Bedürftigsten, die sich am Markt gar nicht behaupten können. Das lässt sich auch in den meisten anderen europäischen Ländern beobachten.
Wie kam es dazu?
Im Vordergrund stand in den achtziger und neunziger Jahren das Argument, öffentlicher Wohnungsbau sei zu teuer. Aber es ging um einen viel umfassenderen politischen Wandel. Die Ansicht setzte sich durch, dass die Wohnungsfrage gelöst, staatliche Intervention nicht mehr nötig sei und der Markt das besser organisieren könne. Die Folge dieses Prioritätenwandels war Deregulierung: Wohnen ist ein reines Privatbedürfnis, das auf dem Markt befriedigt werden soll.
»Schweden war in den Siebzigern das Land mit dem höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrad und vielen Streiks.«
Dass das nicht klappt, sehen wir heute. Es sind politische Entscheidungen gewesen, die Deutschland, und insbesondere Berlin, zu so einem gewinnträchtigen Standort für Immobilieninvestitionen gemacht haben. Über viele Jahrzehnte galt der Wohnungsmarkt als viel zu kompliziert und kleinteilig für große und internationale Investoren. Erst durch die Liberalisierung des Wohnungsmarktes und den umfassenden Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände ab den neunziger Jahren entstand ein Markt, der durch hohe Renditeerwartungen bestimmt ist, was zu permanenten Mietsteigerungen und Preisspekulationen führt.
Warum haben Sie eine Vortragsreihe über Wohnbauprojekte der Vergangenheit organisiert?
Wir wollten zeigen, dass es auch anders geht. Die Geschichte zeigt, dass der Markt die Wohnungsfrage nicht lösen konnte. Deswegen wurden in zahlreichen Ländern unterschiedliche Projekte des öffentlichen Wohnungsbaus entwickelt und Millionen von Wohnungen mit öffentlich Mitteln finanziert.
Die Probleme der Wohnungsnot waren dabei ähnlich, aber die Antworten waren sehr unterschiedlich. Sie lassen sich heutzutage nicht einfach kopieren. Aber man sieht, was möglich ist, wenn man Wohnen nicht als Ware sieht, sondern als notwendiges Gut, das als Infrastruktur bereitgestellt wird wie Straßen oder Schulen. Unsere ›Archäologie der Wohnutopien‹ zeigt, dass vieles in Frage gestellt wurde, was einem heute selbstverständlich scheint. Nur ein Beispiel: In Schweden wurden und werden teilweise heute noch die Mieten zwischen Mietergewerkschaften und Vermieter:innen verhandelt. Oder ein anderes Beispiel: Allgemein empfindet man es heute als fair, dass Menschen mit höherem Einkommen mehr Miete zahlen. Aber in den Niederlanden zahlten in den regulierten Mietwohnungen alle gleich viel Miete. Das Prinzip war: Jede:r hat ein Recht auf Wohnen und es soll kein Geld damit verdient werden.
Diese Projekte sind heutzutage oft vergessen. Bei jedem unserer Vorträge zeigt sich, dass Formen der Wohnversorgung, die lange als normal galten und funktionierten, heute nicht mehr bekannt sind.
Was waren die politischen und sozialen Bedingungen für die großen Bauprogramme der Vergangenheit?
Ausgangspunkt war in allen Fällen eine große Wohnungsnot und miserable Wohnverhältnisse als Folge von Industrialisierung, Urbanisierung oder Krieg, so dass es einen gesellschaftlichen Konsens gab, hier einzugreifen. Treibende Kraft waren meist linke politische Organisationen. Schweden war beispielsweise in den siebziger Jahren das Land mit dem höchsten gewerkschaftlichen Organisationsgrad in Europa und vielen Streiks. Sonst hätte es das schwedische »Millionenprogramm«, bei dem die Regierung das Ziel ausgab, bis 1975 eine Million Wohnungen zu bauen, nicht gegeben.
Zugleich zeigen viele der Beispiele, dass diese Programme Ergebnis von politischen Kompromissen zwischen konservativen, liberalen, sozialdemokratischen und kommunistischen Kräften waren. Öffentliche Wohnungsbauprogramme sind geprägt durch Experimente und Pragmatismus, getragen von der Übereinkunft, dass die Wohnungsnot gelöst werden muss, auch um die Gesamtwirtschaft anzukurbeln.
Was für gesellschaftliche Ideen drückten sich in den jeweiligen Programmen aus?
Grundlegend war, dass Wohnen als Grundbedürfnis gilt, das erfüllt werden muss. Wohnen sollte nicht den Lohn auffressen. Erst kommt das Essen, dann die Miete, war eine Forderung in Schweden. Eindrucksvoll sieht man das an der Entwicklung der Wohnkosten in den Niederlanden: Bis 1980 haben die Menschen dort weniger als zehn Prozent ihres Lohns für die Miete ausgegeben – heute sind es durchschnittlich 37 Prozent.
»Meist hat der schlechte Ruf öffentlicher Wohnbauten weniger mit den Gebäuden zu tun als mit der Art und Weise, wie die Menschen, die dort wohnen, behandelt werden, und welche Möglichkeiten und Perspektiven die Gesellschaft ihnen einräumt.«
Prägend war außerdem die Überzeugung, dass Wohnen keine Privatangelegenheit ist, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe, zu der mehr als nur das Dach über dem Kopf gehört. Oft waren diese Wohnbauprogramme mit der Einrichtung sozialer und kultureller Infrastrukturen verbunden, und die entstehenden Viertel waren nicht nur für Arme, sondern Arbeiter:innen und die Professorin wohnten nebeneinander. In Jugoslawien waren es sogar eher die Privilegierten, die in den Plattenbauten lebten. Dort war Wohnen und die soziale Reproduktion eng mit der Produktion verknüpft, Wohnen wurde durch die gemeinsame Arbeit finanziert. Und dazu gehörte auch Mitbestimmung oder gar Selbstverwaltung des Wohnens, Mieterräte und Mietergewerkschaften.
Was davon könnte Vorbild für heute sein?
Die politischen und ökonomischen Bedingungen haben sich verändert. Doch bestimmte Grundprinzipien bleiben inspirierend: eben Wohnen als öffentliches Gut, das als Infrastruktur bereitgestellt wird, verbunden mit Organisierung der Mietenden. Das unterscheidet sich stark von heutigen Vorstellungen, denen zufolge Sicherheit Eigentum erfordert und sich mit Wohnen grundsätzlich Geld verdienen lassen soll. In diesem System müssen Häuser Ware bleiben und ständig im Wert steigen.
Spielten beim öffentlichen Wohnungsbau im 20. Jahrhundert auch ökologische Überlegungen eine Rolle? Heutzutage wird ja oft sogar mit dem Argument des Klimaschutzes gegen Neubau und für Sanierung älterer Häuser argumentiert.
Im Vordergrund standen gute Wohnverhältnisse. Dazu gehörte auch ein lebenswertes Umfeld mit Parks und sozialer Infrastruktur und natürlich, dass die Wohnungen anständig beheizbar waren. Heute sind Ökologie und Klimaschutz zentral, und es ist richtig, dass die wirklich große Aufgabe der Umbau und die ökologische Ertüchtigung des Bestandes ist, auch wenn ein gewisser Neubau nötig bleiben wird. Wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, sind enorme Investitionen notwendig. Das ist die eigentliche Wohnungskrise heute, die in ihrem Ausmaß durchaus mit der Wohnungsnot der Vergangenheit vergleichbar ist. So wie es früher galt, bezahlbare Wohnungen zu schaffen, müssen heute die bestehenden bezahlbar umgebaut werden. Das kann der Markt nicht leisten. Das Debakel des Heizungsgesetzes zeigt, dass extreme soziale Härten entstehen können und am Ende die Mieter:innen den Umbau zahlen.
Heutzutage ist der Ruf von sozialen Bauprojekten oft sehr schlecht – sie stehen für trostlose Architektur, soziale Probleme und auch gescheiterte urbane Ideen, die beispielsweise zu Ghettobildung führten. Ist das berechtigt? Und welche Lehren zieht man daraus?
Ja, diese Kritik gab immer wieder auch von Linken, die beispielsweise kritisierten, dass Wohnviertel in den Innenstädten abgerissen und die Arbeiter:innen in den Betonschlafstädten vor dem Fernseher ruhiggestellt werden. Aber diese pauschale Bild zerbröselt meist bei genauerem Hinsehen. Die öffentlichen Wohnbauprogramme haben in jedem europäischen Land hochwertigen Wohnraum geschaffen, der teils auch heute noch begehrt ist. Ich will damit nicht sagen, dass es keine berechtigte Kritik gibt. Teils war die Bauqualität wirklich schlecht; zudem hat die moderne Idee der Trabantenstädte viele unwirtliche Stadtteile hervorgebracht, was aber oft auch daran lag, dass notwendige Infrastruktur nicht gebaut wurde. Doch meist hat der schlechte Ruf solcher öffentlichen Wohnbauten weniger mit den Gebäuden zu tun als mit der Art und Weise, wie die Menschen, die dort wohnen, behandelt werden, und welche Möglichkeiten und Perspektiven die Gesellschaft ihnen einräumt. Die Stigmatisierung solcher Räume ist vor allem Ausdruck sozialer Ungleichheit.
Vortragsreihe »Vergessene Utopien des Wohnens – Internationale Praxisbeispiele«: Expert:innen stellten dort öffentliche Wohnungsbauprogramme aus dem 20. Jahrhundert vor: das sogenannte Millionenprogramm in Schweden, selbstverwaltetes Wohnen in Jugoslawien und öffentlich finanzierte Wohnbauvereinigungen in Amsterdam. Im Herbst folgen Vorträge zum »council housing« in Großbritannien, dem Wohnungsbau im »Roten Wien« und in der DDR.