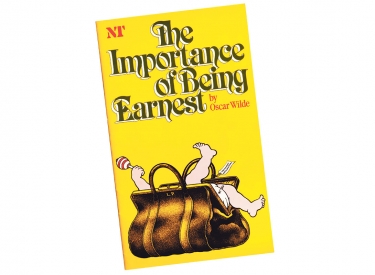Mit den Juden lachen lernen
Bei einem seiner späten Auftritte hat Georg Kreisler erzählt, dass ihn nach einem in Deutschland absolvierten Bühnenabend einmal ein Zuschauer mit den Worten angesprochen habe: »Sie wissen, was jüdischer Humor ist, Herr Kreisler! Können Sie mir erklären, warum die Juden heute kaum noch Witze machen?«
Die Anekdote bringt auf den Punkt, weshalb die postnazistische Begeisterung für jüdischen Humor so zwiespältig ist. Zwiespältig wohlgemerkt, nicht einfach unangemessen: Denn bei aller unfreiwillig komischen Geschmacklosigkeit zeugt die kolportierte Äußerung auch von einer ehrlichen Begeisterung für das, was Deutsche am jüdischen Witz als ihnen vertraut und trotzdem fern, als historisch verloren und doch unverlierbar ansehen.
Sprache, nicht allein die deutsche, ist dem jüdischen Humor kein bloßes Mittel, sondern Bewegungsgesetz der Reflexion, der Ironie und Komik, die durch sie hindurch hervorgebracht werden.
Die heterodoxe Popularität, die nicht nur Kreisler, sondern etwa auch Edgar Hilsenrath und George Tabori hierzulande genossen haben und von der heute noch Oliver Polak und sogar Henryk M. Broder zehren, verdankt sich nicht allein einem philosemitisch camouflierten schlechten Gewissen, sondern einer affektiven Nostalgie. Diese beruht nicht nur auf Projektion, sondern verweist auf historische Erfahrungen. Das jüdische Kabarett und Chanson, deren Traditionen Kreisler aufgegriffen hat, waren für die Unterhaltungskunst der Weimarer Republik prägend. Zugleich riefen sie die populäre Kultur des untergegangenen Habsburger Reichs in Erinnerung, die auf unterschiedliche Weise in der Literatur von Joseph Roth, Karl Kraus und Arthur Schnitzler gegenwärtig gewesen ist.
Der jüdische Humor, der genre- und niveauübergreifend alle diese literarischen und theatralen Hervorbringungen prägte, drückt sich zuvorderst in seinem Umgang mit der Sprache aus. Sprache, nicht allein die deutsche, ist dem jüdischen Humor kein bloßes Mittel, sondern Bewegungsgesetz der Reflexion, der Ironie und Komik, die durch sie hindurch hervorgebracht werden. Deshalb, weniger wegen seiner eigenen jüdischen Zugehörigkeit, hat sich Sigmund Freud in der 1905 erschienenen Studie »Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten« ausführlich mit dem jüdischen Witz beschäftigt.
Mischung aus Heiterkeit, Trauer und schneidender Distanz
Die destruktiv-produktive Beziehung der Sprache zu sich selbst, die sich im jüdischen Witz ergibt, setzt innigste Vertrautheit mit dem sprachlichen Material ebenso wie souveräne Distanz voraus. Deshalb ist das Selbstverhältnis, die sich in solchem Humor artikuliert, weder einverstanden-affirmativ noch herablassend. Eher bringt es das bei aller Trauer doch heitere Bewusstsein der Gebrochenheit des Subjekts zum Ausdruck, das Voraussetzung seiner Selbstmächtigkeit ist.
Der Mischung aus Heiterkeit, Trauer und schneidender Distanz, die sich im jüdischen Witz zeigt, wird hierzulande bis heute mit einer von Neid grundierten Hochachtung begegnet, die nie frei vom Ressentiment ist. Exemplarisch hierfür ist die doppeldeutige Beliebtheit Ephraim Kishons in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Kishon, dessen 100. Geburtstag am 23. August dieses Jahres gefeiert wird, hieß eigentlich Ferenc Hoffmann und entstammte einer jüdisch-ungarischen Familie.
Sein satirisches Werk lebt von den mit- und nebeneinander vergegenwärtigten Erfahrungen der nationalsozialistischen Verfolgung, des Totalitarismus in den Staaten des Ostblocks und des Alltags in Israel. Zahlreiche Mitglieder seiner Familie sind in Auschwitz ermordet worden, er selbst, seine Eltern und seine Schwester überlebten. 1944 wurde er in das im damaligen Ungarn gelegene Arbeitslager Jelšava deportiert, 1945 geriet er über einen sowjetischen Gefangenentransport in den Gulag, dem er entkommen konnte. Die Erfahrungen der Deportation und Flucht hat er 1990 in seinem autobiographischen Buch »Undank ist der Welten Lohn« beschrieben.
1948 begann er ein Studium der Kunstgeschichte in Budapest, wanderte aber schon ein Jahr später mit seiner Frau über Italien nach Israel aus. Seit 1952 schrieb er unter Pseudonym auf Hebräisch für die Tageszeitung Maariv sowie für verschiedene US-amerikanische Zeitungen und arbeitete als Autor von Theaterstücken. Sein erster internationaler Erfolg war 1959 »Drehn Sie sich um, Frau Lot!«, eine Sammlung »israelischer Satiren«.
Einer der beliebtesten Autoren satirischer Kurzprosa in der Bundesrepublik
In den sechziger und siebziger Jahre avancierte Kishon, in den Übersetzungen von Friedrich Torberg und Gerhard Bronner, der wiederum in den fünfziger Jahren mit Georg Kreisler zusammenarbeitete, zu einem der beliebtesten Autoren satirischer Kurzprosa in der Bundesrepublik. Auch die 1971 als Hörspiel und Theaterstück erschienene Bürokratiesatire »Der Blaumilchkanal« war dort sehr populär.
Dass es österreichische Autoren waren, die Kishon ins Deutsche übertrugen, ist kein Zufall. In ihrer Studie »Israelische Satiren für ein bundesdeutsches Publikum« zeigt die Germanistin Birgit M. Körner die Affinitäten auf, die zwischen Kishons Texten und denen Torbergs bestanden, und rekonstruiert die Fehlwahrnehmungen und Entstellungen, die den Kishon-Übersetzungen in der Bundesrepublik widerfuhren, paradoxerweise aber seine Bekanntheit beförderten.
Torberg, 16 Jahre älter als Kishon, kam aus einer Prager jüdischen Familie und emigrierte nach dem »Anschluss« Österreichs 1938 nach Zürich, 1939 nach Frankreich und schließlich in die USA, wo er als Drehbuchautor und als Informant für das FBI tätig war, in dessen Auftrag er Bertolt Brecht observierte. 1951 kehrte er nach Wien zurück, arbeitete für Die Presse, für den von den USA betriebenen Radiosender Rot-Weiß-Rot und als Übersetzer.
In den fünfziger Jahren polemisierte er gegen Autoren, die er kommunistischer Sympathien verdächtigte – darunter Thomas Mann und Günther Anders –, und setzte mit dem Literaturkritiker Hans Weigel einen Boykott von Brechts Stücken an österreichischen Theatern durch, der bis 1963 Gültigkeit hatte. Torberg engagierte sich für die Anerkennung des österreichischen Deutschen als eigenständige Sprache und warnte vor der »Verpreußung« seines Landes. 1961 veröffentlichte er in der Zeitschrift Der Monat eine vielbeachtete Kritik der von Salcia Landmann herausgegebenen Textsammlung »Der jüdische Witz«, der er vorwarf, antisemitische Klischees vom jüdischen Humor zu bestätigen.
Obwohl Körners Buch im Stil des akademischen Postmodernismus geschrieben ist und, wann immer es um Erscheinungsformen jüdischen Humors geht, von bloßen »Konstruktionen« spricht, ist es ergiebig, weil es die lebens- und sprachgeschichtlichen Differenzen zwischen Kishons, Torbergs und der bundesrepublikanischen Auffassung jüdischen Humors herausarbeitet.
Die bundesrepublikanische Rezeption von Kishons Satiren stand unter der die Wirklichkeit ebenso wie die Qualität von Kishons Texten verleugnenden Maxime, jüdischer Humor lasse sich wahrnehmen, »als wäre nichts geschehen«
Während Kishons Adaption des jüdischen Witzes, beginnend mit seinen Glossen für Maariv über seine Parodien deutscher und israelischer Sozialcharaktere bis hin zur auf den israelischen Staat gemünzten Bürokratiekritik, von Körner als Erscheinungsformen eines »Humors als Überlebensstrategie« gedeutet wird, war der von Torberg unternommene Versuch einer Rettung des jüdischen Witzes eine Geste der Restauration: als Wiederanknüpfung an eine deutschsprachige jüdische Tradition aus der Zeit vor 1933, die Torberg als verschüttet, aber nicht zerstört ansah und die er »mit wehmütigem Lächeln« evozierte. Kishons Bezugspunkt war die Vernichtung der europäischen Juden, von der auch sein Blick auf das gegenwärtige Israel bestimmt war; der von Torberg die Epoche vor der Zeit des Nationalsozialismus, deren Nachklänge er in der Gegenwart aufspüren wollte.
Die bundesrepublikanische Rezeption von Kishons Satiren schloss zwar an Torbergs Übersetzungen an, war ihnen gegenüber aber etwas Drittes, Problematischeres: Sie stand unter der die Wirklichkeit ebenso wie die Qualität von Kishons Texten verleugnenden Maxime, jüdischer Humor lasse sich wahrnehmen, »als wäre nichts geschehen«. Mehr noch, gerade solche Verleugnung erschien als Form der Versöhnung, indem der jüdische Witz den Deutschen erlaube, von und mit den Juden wieder das Lachen zu lernen.
Dem stehen Äußerungen in Texten und Interviews entgegen, mit denen Kishon bis zu seinem Tod im Jahr 2005 nicht nur das wiedergutgewordene Deutschland, sondern auch den sogenannten Nahostkonflikt glossiert und dabei immer wieder die Partei Israels ergriffen hat. Dass diese Parteinahme mit Kritik am politischen und gesellschaftlichen Alltag in Israel einherging, war, anders als Kishons falsche Freunde und Feinde glauben, weder für ihn noch in seinem Werk ein Widerspruch.
Birgit M. Körner: Israelische Satiren für ein westdeutsches Publikum. Ephraim Kishon, Friedrich Torberg und die Konstruktionen »jüdischen Humors« nach der Schoah. Neofelis-Verlag, Berlin 2024, 240 Seiten, 19 Euro